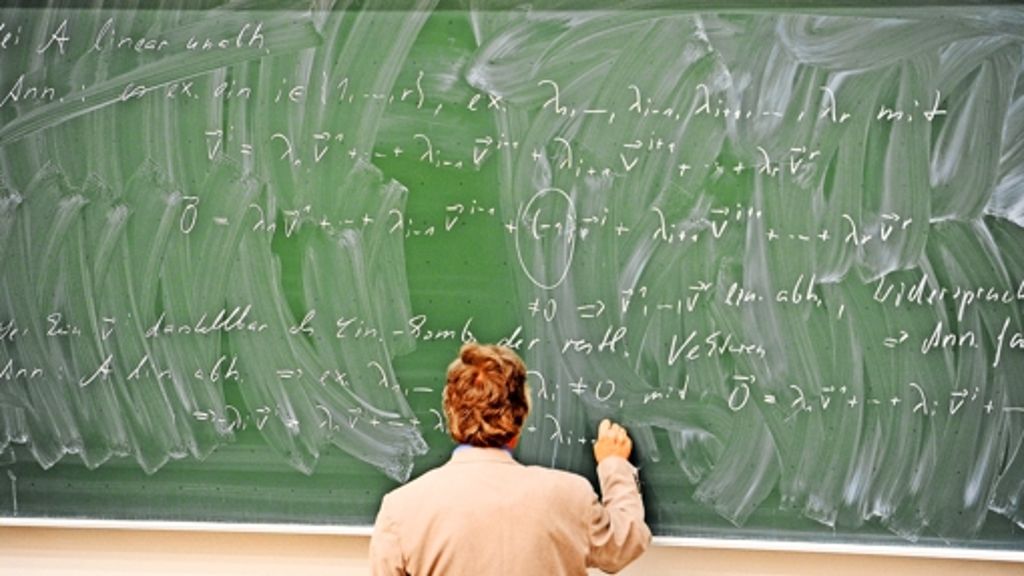Professor zu werden ist ein riskantes Projekt: viele Jahre Arbeiten und Bangen – und dann kann es trotzdem schiefgehen. Oft fehlt Nachwuchsforschern auch die Zeit, sich für eine Professur zu qualifizieren. Ein Blick in den Arbeitsalltag junger Wissenschaftler.
Stuttgart - Die Diagnose ist fast hundert Jahre alt, aber sie ist heute noch gültig: „Das akademische Leben ist ein wildes Hasard.“ Der Satz stammt von dem Soziologen und Ökonomen Max Weber, der im November 1917 in München vor rund hundert Studenten über die Wissenschaft als Beruf sprach. Weber war damals 53 Jahre alt. Schon mit Anfang 30 war er Professor geworden: erst in Freiburg und dann in Heidelberg. Doch seinen Zuhörern, die womöglich ähnliche Ambitionen hatten, macht er wenig Hoffnung: Er selbst habe seine frühe Berufung „einigen absoluten Zufälligkeiten zu verdanken“, und er kenne viele, „die trotz aller Tüchtigkeit innerhalb dieses Ausleseapparats nicht an die Stelle gelangen, die ihnen gebühren würde“.
Es gibt prominente Ausnahmen von dem Apparat, den Max Weber beschreibt. Einen Monat zuvor wurde in Berlin das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik gegründet und, weil das Gebäude erst in den 1930er Jahren fertig werden sollte, in der Privatwohnung seines Direktors Albert Einstein untergebracht. Schon zuvor war Einstein nach Berlin gelockt worden mit dem Versprechen einer Professur, bei der er keine Vorlesungen und Seminare geben muss. Auch das neue Institut war auf ihn zugeschnitten: möglichst viel freie Zeit für den prominenten Physiker.
Wie anders hatte Albert Einsteins Leben zehn Jahre zuvor ausgesehen: Mit seinen Bewerbungen auf Universitätsstellen kam er nicht durch, und auch sein Antrag auf Habilitation – also das Recht und die Pflicht zur Lehre – wurde zunächst abgelehnt. Doch einige Größen des Fachs, vor allem Max Planck, waren auf den jungen Physiker aufmerksam geworden, der am Patentamt in Bern gewissermaßen nebenberuflich die Physik revolutionierte.
Verträge laufen nur einige Monate
Für die allermeisten bedeutet heute wie vor hundert Jahren eine wissenschaftliche Karriere ein langes Kämpfen und Hoffen, bis man es endlich auf eine unbefristete Stelle schafft: die Professur. Fast alle Stationen auf dem Weg dorthin sind nur auf Zeit – oft laufen die Verträge nicht einmal ein Jahr. Der Wissenschaftsrat in Köln, der die Politik in Forschungsfragen berät, hat vor zwei Monaten empfohlen, mehr Dauerstellen unterhalb der Professur einzurichten. Auch seine Diagnose lautet: „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine Professur anstreben, gehen in einigen Fächern ein beträchtliches Risiko ein.“ Wer an einer deutschen Universität oder Hochschule zum Professor ernannt wird, ist im Durchschnitt schon 41 Jahre alt. Falls dieser Plan aber schiefgeht, ist es nur schwer möglich, noch eine neue Karriere einzuschlagen.
Einer der Gründe für die zuweilen zufällig wirkenden Personalentscheidungen ist für Max Weber das doppelgesichtige Stellenprofil: Professoren müssen nicht nur gut forschen, sondern auch gut lehren. „Beides fällt ganz und gar nicht zusammen.“ Die Hochschule muss sich also aussuchen, was ihr wichtiger ist. Heute sind die Anforderungen sogar höher als zu Max Webers Zeiten, wie ein Blick in die aktuellen Stellenausschreibungen der Stuttgarter Hochschulen zeigt. Dort wird zum Beispiel die Bereitschaft zur fachübergreifenden Kooperation gefordert, zuweilen werden gleich die Projekte und Institute genannt, um die sich der Kandidat kümmern soll.
Nach Ansicht mancher Soziologen hat sich in der Wissenschaft ein neuer Arbeitsmodus entwickelt: In diesem Modus kann die Frage, die am Anfang der Forschung steht, nicht mehr einer einzelnen Disziplin zugeordnet werden. Albert Einstein hat sich zum Beispiel noch gefragt, warum die Versuche gescheitert sind, einen Äther nachzuweisen – ein Medium, durch das Licht und Radiowellen übertragen werden. Das war eine rein physikalische Aufgabe, die er mit physikalischen Mitteln löste.
Es wird Zählbares erwartet
Die nächsten Einsteins lösen jedoch andere Aufgaben. Sie sollen zum Beispiel die Chancen und Risiken der Energiewende ermitteln. Es geht also um große Kraftwerke und die Effizienz von Solarzellen, aber auch um den Netzausbau und die soziale Akzeptanz, so dass Forscher aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen. Sie alle arbeiten unter der Beobachtung von Politik und Öffentlichkeit. Unbedachte Äußerungen, etwa zur üblichen statistischen Bearbeitung der Daten, können das Publikum irritieren: Wird hier etwa mit Statistik getrickst?
In den Stellenausschreibungen für Professuren wird außerdem Zählbares erwartet: Veröffentlichungen in herausragenden Fachzeitschriften und die „Fähigkeit zur Einwerbung von Drittmitteln“. Es wird automatisiert ausgezählt, welcher Fachartikel und welcher Autor wie oft von seinen Kollegen zitiert wird. Je mehr man zitiert wird, umso wichtiger war wohl, was man geschrieben hat – so die Logik. Daraus lassen sich Kennzahlen für Fachjournale und auch für einzelne Wissenschaftler errechnen – und immer wieder wird davor gewarnt, einen jungen Forscher auf diese Zahlen zu reduzieren. Trotzdem hält sich die Warnung: „publish or perish“ – veröffentliche Fachartikel oder gehe unter!
Außerdem sollen die Bewerber auf einen Lehrstuhl nachweisen, dass sie bei Förderorganisationen, beim Bund, der EU oder bei Stiftungen und Unternehmen erfolgreich Projekte beantragen können. Diese Mittel, die Drittmittel genannt werden, weil sie nicht aus dem Etat der Hochschule oder vom Landesministerium kommen, machen inzwischen mehr als 15 Prozent der Hochschuleinnahmen aus – die Tendenz ist seit Jahren steigend. Für Albert Einstein spielte das noch keine Rolle. Da er selbst nicht experimentierte, nutzte er seinen Institutsetat, um für Kollegen Messgeräte zu kaufen und Stipendien zu verteilen.
Der Vorgesetzte ist mächtig
Die Post-Docs, wie Forscher nach der Promotion genannt werden, müssen also viele Erwartungen erfüllen – und befürchten, es trotzdem nicht zu schaffen. Die Global Young Academy, die in Berlin gegründet wurde, hat im vergangenen Jahr Post-Docs nach ihrer Sicht der Dinge befragt. Die 100 Deutschen unter den Befragten schätzen ihre Chancen auf eine Professur im Durchschnitt mit nur 29 Prozent ein.
Die deutschen Post-Docs arbeiten im Durchschnitt 50 Stunden in der Woche. In der Vorlesungszeit kommen sie aber zu ihrem Leidwesen nur 16 Stunden lang zum Forschen, in den Semesterferien sind es 22 Stunden. Auch der Wissenschaftsrat hält zwar fest: „Das Interesse am Karriereziel Universitätsprofessur beruht nach wie vor auf einer hohen intrinsisch wissenschaftlichen Motivation.“ Sprich: junge Wissenschaftler wollen Professor werden, weil sie sich für ihr Fach begeistern und die Forschung voranbringen möchten. Doch problematisch sei, schreibt der Wissenschaftsrat in seiner Stellungnahme vom Juli, „dass der originäre Reiz einer Professur aus Sicht promovierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch ihr jetziges Aufgabenprofil beeinträchtigt wird.“ Ihnen werden viele Aufgaben aufgehalst, die sie davon abhalten, sich für eine Professur zu qualifizieren. Dazu trägt nach Ansicht des Wissenschaftsrats vor allem bei, dass die jungen Forscher oft von einem Professor abhängig sind, der ihren Arbeitsvertrag verlängern muss.
Diese Abhängigkeiten gab es in der Wissenschaft schon vor hundert Jahren. Albert Einstein hatte in Max Planck einen der einflussreichsten Förderer gefunden, den man sich vorstellen kann. Auch heute kümmern sich viele Professoren um ihre Mitarbeiter, stellen etwa in ihren Vorträgen deren Arbeitsergebnisse vor. Das erkennt auch der Wissenschaftsrat an, doch er beklagt, dass es keine transparenten Kriterien gebe. Wenn es um die Verlängerung des Arbeitsvertrags gehe, sei alles offen. Für Post-Docs entstehe der Eindruck, „dass Karrieren eher von zufälligen Bedingungskonstellationen als von Leistung abhängen“.
Drei junge Forscherinnen im Porträt
Serie
Wie sieht der Alltag eines Wissenschaftlers heute aus? An den kommenden drei Montagen porträtieren wir junge Forscher aus Baden-Württemberg. Sie erzählen, wie sich die Arbeitsbedingungen gewandelt haben und wie sie damit zurechtkommen. Zum Job eines Forschers gehört nicht nur das Forschen und Lehren, sondern auch das Einwerben von Fördermitteln, das Managen einer Arbeitsgruppe und die Öffentlichkeitsarbeit. Das Bild des einsam arbeitenden Genies, wie man es beispielsweise mit Albert Einstein verbindet, hat ausgedient.
Menschen
Die Wissenschaft ist auch heute noch eine Männerdomäne: Auf vier Professoren kommt eine Professorin, obwohl rund die Hälfte der Studierenden Frauen sind. Doch es gibt viele ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen. In der Serie kommen drei von ihnen zu Wort: die Klimaforscherin Corinna Hoose aus Karlsruhe, die Stuttgarter Physikerin Uta Schlickum und die Humangenetikerin Claudia Scholl, die kürzlich von Ulm nach Heidelberg gewechselt ist.