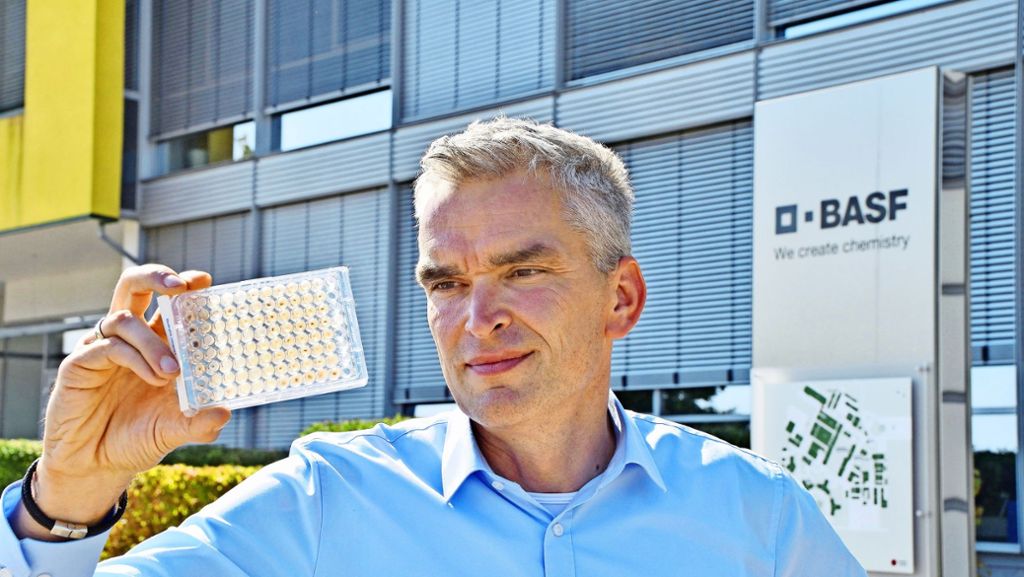Die BASF ist einer der größten Produzenten von Spritzmitteln weltweit. Doch der Konzern wagt den Spagat – und finanziert etwa Studien, wie man zügig das Insektensterben beenden kann. Ergebnisse liegen bereits vor.
Ludwigshafen - Natürlich, die BASF gehört mit ihrem riesigen Portfolio an Pestiziden auf die böse Seite der Macht – davon sind viele Naturschützer überzeugt, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vorrangig für das Insektensterben verantwortlich machen. Tatsächlich ist der Ludwigshafener Konzern seit der Übernahme eines Teils der Firma Bayer vor wenigen Wochen zum weltweit viertgrößten Hersteller von Pflanzenschutzmitteln aufgestiegen. Aber sobald man sich im Limburgerhof, dem Agrarforschungszentrum der BASF in der Pfalz mit 1700 Mitarbeitern, etwas näher umsieht, bekommt das schön gepflegte Feindbild Risse. Vor allem merkt man: Der Feind hat ein Gewissen.
Matthias Kastriotis, der Sprecher der BASF Agricultural Solutions, wie der Sektor in dem global agierenden Unternehmen heißt, bringt das Weltbild zunächst mit ein paar Fakten ins Wanken. So habe die BASF die am meisten umstrittenen Spritzmittel – Neonicotinoide und Glyphosat – gar nicht im Programm. „Das hat historische Gründe“, sagt Kastriotis: „Wir hatten schon immer einen Schwerpunkt bei Herbiziden und Fungiziden.“ Und um die Spritzmittel möglichst sicher zu machen, werde viel Geld investiert: Der Bereich trägt nur neun Prozent zum Umsatz der BASF bei, erhält aber 27 Prozent aller Forschungsgelder.
Berater helfen Bauern auf den Höfen
Vor allem aber tut die BASF etwas, was man zunächst nicht von ihr erwarten würde: Sie kümmert sich um eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft. Noch ist die Abteilung Nachhaltigkeit, die Andreas Schumacher leitet, mit fünf Mitarbeitern sehr klein; doch sie kooperiert mit 90 Beratern, die zu den Bauern auf die Höfe gehen. Dabei strebe man zunehmend ein ganzheitliches Denken an, sagt Schumacher.
So eröffne die Digitalisierung der Landwirtschaft große Chancen: Die Daten etwa über den Bodenzustand und das Wetter führten dazu, dass man Pflanzenschutzmittel gezielter und damit schonender einsetzen könne. Auch schlechte Böden werfen Gewinn ab, wenn man dort Blühstreifen anlege und Fördergeld erhalte. Und mit neuen Sorten – durch die Bayer-Übernahme hat BASF erstmals auch Saatgut im Angebot – könne man den Ertrag steigern.
Das Geschäft der Zukunft
Untergräbt das Unternehmen nicht sein eigenes Geschäft, wenn weniger Pflanzenschutzmittel verkauft würden, fragt man sich. „Nein, das Geschäftsmodell ändert sich nur“, sagt Schumacher. Der 49-Jährige ist Landwirtschaftsmeister und Betriebswirtschaftler, hat selbst schon im Außendienst Spritzmittel verkauft und hatte zuletzt bei der BASF die Landesleitung für Tschechien inne. Bewusst sei er Chef der Abteilung Nachhaltigkeit geworden: „Das ist ein sehr entscheidender Bereich der Zukunft.“ Auch beim Thema Insektensterben schaue man nicht weg. Schon seit fünf Jahren finanziere das Unternehmen Analysen und Lösungsansätze beispielhaft auf zehn Höfen in Deutschland; externe Institute und bei einem Projekt sogar der Naturschutzverband Südpfalz haben die Aufgabe übernommen. Dabei investiere BASF eine niedrige einstellige Millionensumme. Vor allem aber hat man früh begonnen: Während viele Programme der Politik erst angelaufen sind, gibt es hier Ergebnisse.
Die zentrale Erkenntnis für Andreas Schumacher: „Vor allem der Verlust des Lebensraums ist verantwortlich für den Rückgang von Vögeln und Insekten.“ Auf den Feldern der zehn Höfe hat man deshalb Blühstreifen mit ausgewogenen Samenmischungen angelegt. Es wurden Stein- und Totholzhaufen geschaffen und Hecken gepflanzt. Und es wurden Nisthilfen aufgestellt und sogenannte Feldlerchenfenster angelegt – das sind rechteckige Lücken mitten in den Weizenfeldern, wo die Lerchen brüten und Nahrung finden können.
Die Zahl der Arten wächst
Dadurch habe sich die Zahl der Wildbienenarten zwischen 2013 und 2017 teils verdreifacht, die Zahl der Spinnenarten wuchs um 67 Prozent, die Zahl der Feldlerchen um 38 Prozent. Nicht sehr erfolgreich ist das Programm dagegen bei Braunkehlchen oder Kiebitz. Matthias Kastriotis wünscht sich angesichts der Ergebnisse, dass man aufhört mit den Debatten und den oft emotionalen Schuldzuweisungen und dass man anfängt, etwas gegen das Artensterben zu tun. Die Vorschläge der BASF seien sofort umsetzbar. Auch Schumacher betont: „Wir sind überzeugt, dass Biodiversität mit moderner Landwirtschaft zusammengeht.“
Pflanzenschutzmittel gehören in dieser Landwirtschaft nach wie vor dazu. Die Biologin Inge Weber, die oft Gäste durch den Limburgerhof führt, ist überzeugt, dass ohne Spritzmittel die Menschheit nicht mehr ernährt werden könnte: „In den Entwicklungsländern hungert jedes sechste Kind. Alle satt zu machen ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.“ So läuft bei der BASF ein gigantischer Apparat, um neue Mittel zu entwickeln. Es gibt auf dem Limburgerhof vollautomatische Labore, in denen Roboter jährlich bis zu 80 000 Substanzen daraufhin prüfen, ob sie herbizide oder fungizide Eigenschaften haben. Große Hoffnung setzt BASF auf das „Blockbuster-Fungizid“ Revysol, das 2019 auf den Markt kommen und bis zu einer Milliarde Euro Umsatz im Jahr bringen soll. Von 140 000 getesteten Substanzen schaffe es am Ende eine zur Marktreife.
Pflanzenschutz: Restrisiko bleibt
Ein Restrisiko bleibe auch bei Pflanzenschutzmitteln, das räumt Andreas Schumacher ein. Aber ein Präparat werde zehn Jahre lang entwickelt, im Schnitt investiere BASF 286 Millionen Euro pro Mittel bis zur Produktion. Unzählige Behörden seien mit der Zulassung beschäftigt, rund 32 000 Seiten umfasse der Antrag für eine neue Substanz. Da spricht Matthias Kastriotis schon von „maximaler Sicherheit“.
Wissenschaftler stellen aber mittlerweile verstärkt fest, dass nicht das einzelne Mittel problematisch ist, sondern das Zusammenspiel mehrerer Chemikalien oder die Kombination von Spritzmitteln und anderen Umwelteinflüssen, etwa dem Stress von Fischen durch zu warmes Wasser. Das stellt Kastriotis nicht in Abrede, sagt aber: Jede Zulassung gelte nur drei Jahre und müsse dann neu beantragt werden. „Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden dann eingebracht.“