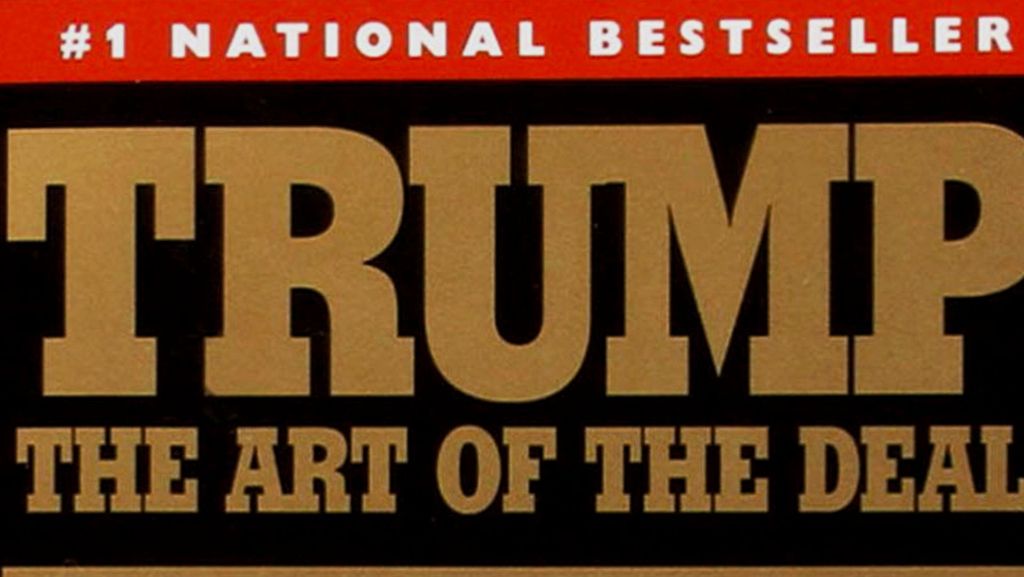Menschenrechte, Demokratie, Ausgleich der Interessen, globale Zusammenarbeit, Vielfalt der Kulturen: die Ideen und Werte des Westens sind nicht mehr selbstverständlich. Alte und neue Feinde formieren sich. Zum Beispiel: die Rede vom Deal.
Stuttgart - Man kann Donald Trump wirklich nicht für alles verantwortlich machen, was in der Weltpolitik gerade schiefläuft. Aber die Rede vom „guten Deal“, den die Politik anzustreben habe, um das eigene Land wirklich voranzubringen, diese Rede hat er seit seinem Amtsantritt als US-Präsident im Januar 2017 weltweit populär gemacht. Plötzlich scheint nicht mehr das Ziel zu sein, in einem möglichst vollständigen Kreis aller Betroffenen über gemeinsame Interessen und Ziele nachzudenken und eventuell nötige Kompromisse auszuhandeln, sondern es geht darum, unter den wirklich Wichtigen ein gutes Geschäft miteinander abzuschließen.
Von 1987 stammt das Buch, in dem der Unternehmer und Spekulant Donald Trump mithilfe des Journalisten Tony Schwartz sein Geschäftsmodell beschrieb: „The Art of the Deal“. In den USA war das Buch schnell ein Bestseller, selbst die heute so Trump-kritische „New York Times“ jubelte zum Erscheinen: „Trump lässt uns für einen Moment wieder an den amerikanischen Traum glauben.“ In deutschen Beiträgen wird der Buchtitel gern übersetzt mit „Die Kunst des Erfolgs“ – was allerdings eine etwas fahrlässige Übertragung ist. „Deal“ meint tatsächlich „Geschäft“. Und ein Teil von Trumps US-Wahlerfolg im November 2016 wurzelt ja tatsächlich in seinem Anspruch und Programm, die Instrumente seines Denkens als erfolgreicher Unternehmer zu übertragen in die politische Lenkung eines Staates und der Gesellschaft. Ein guter Politiker, so die Idee, zeichnet sich nicht aus durch schlaue Reden, hehre Werte, allgemeine Menschenfreundlichkeit. Sondern durch gute Deals.
Was die Übertragung dieser Art unternehmerischen Denkens auf die Politik bedeutet, hat Trump im ersten halben Jahr seiner Amtszeit bereits vielfach bekundet und belegt: Ein Klimaabkommen, das den USA seiner Meinung nach Kosten abverlangt, obwohl es den ganzen Klimawandel gar nicht gibt? Gekündigt. Ein neuer Freihandelsvertrag mit Mexiko? Nur, wenn der Nachbar dafür die Grenzmauer bezahlt. Ein Friedensabkommen zwischen Israel und Palästinensern? Das ist deren Geschäft da hinten in Jerusalem, die sollen den Deal unter sich ausmachen. Eine neue Verständigung mit Russland? Müsste doch möglich sein unter zwei Männern, die sich beim G-20-Gipfel in Hamburg doch spontan so gut verstanden haben wie Trump und Putin.
Es droht eine Herrschaft der Oligarchen
Aber hat Trump nicht womöglich recht? Ist der Kapitalismus nicht just jene Denk- und Organisationsform, die nun wirklich tief in den Werte-Genen des Westens steckt und auch seine Politik strukturieren sollte? Entschieden: Nein. Zwar ist es tatsächlich so, dass die Proklamation freier, autonomer, nach ihrem persönlichen Glück strebender Menschen seit englischer und französischer Aufklärung sich ausdrückt in einem freien Markt, im freien Unternehmertum, im Wettbewerb um Ideen und Waren – also in dem, was man Marktwirtschaft oder Kapitalismus nennen kann. Ein Irrtum aber wäre die Schlussfolgerung, diese westlichen Werte erforderten, den Staat selbst wie ein großes Unternehmen zu sehen und die Gesellschaft als einen reinen Wettbewerbsmarkt der Gruppen und Kulturen. Bestenfalls läge hier ein Missverständnis vor, schlimmstenfalls eine Herrschaft von Oligarchen. Also eine Führung der wenigen wirklich Wichtigen, der Starken, der Tops.
Der „gute Deal“, den zwei Geschäftspartner abmachen, bringt beiden Seiten Gewinn – der aber letztlich von einem Dritten, Vierten oder Fünften zu erwirtschaften oder von ihm zu holen ist. Ein solches Konzept auf dem freien Markt ist weder ehrenrührig noch unmoralisch. Das freie Spiel kann in der Wirtschaft enorme Kräfte und eine starke Dynamik ins Werk setzen. Die weit geöffneten Märkte, wie sie sich nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in den neunziger Jahren weltweit entwickelt haben, später zusätzlich angetrieben durch die neuen digitalisierten Technologien, haben keineswegs, wie oft behauptet, nur wenige Reiche noch reicher gemacht. Insgesamt und im Schnitt haben sich im letzten Vierteljahrhundert die Grundversorgung und der Wohlstand eines großen Teils der Bevölkerung dieser Welt deutlich verbessert.
Eigentlich war Amerika schon beim „New Deal“ angelangt
Unabhängig von diesen Marktregeln braucht aber jede Gesellschaft auch eine Vorstellung von Gerechtigkeit und sozialem Fortschritt, der deutlich über das hinausgeht, was durch gute Deals zu erreichen wäre. In allen freien Gesellschaften stellen sich soziale Fragen, die politische Aktionen erzwingen. Akute Nöte einzelner Gruppen müssen mit öffentlichen Mitteln gelindert, Bedürftige unterstützt werden. Mindestens genauso wichtig ist dann aber auch der Folgeschritt: Eine freie Gesellschaft muss sich als Ziel vor Augen stellen, dass sie niemand aus ihren Reihen vorsätzlich abschreibt oder ausgrenzt, dass sie sich öffnet für den Beitrag und das Engagement möglichst vieler, idealerweise aller.
Als Amerika in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts unter der Weltwirtschaftskrise litt, gab es einen amerikanischen Präsidenten, Franklin D. Roosevelt, der eine ganz eigene, für amerikanische Verhältnisse radikal neue Vorstellung von Deal entwickelte, um sein Land aus der Depression zu holen – einen „New Deal“. Aus drei Säulen bestand sein Programm: aus „relief“, also Erleichterung für die akut Notleidenden, aus „recovery“, Anreizen des Staates für die Wirtschaft zu neuem Wachstum, und aus „reform“, stärkeren Regeln für Börsen und Banken, um gesellschaftlich unerwünschten Auswüchsen der freien Wirtschaftskräfte künftig Einhalt zu gebieten. Nicht, dass Roosevelts „New Deal“ damals alle Probleme gelöst hätte. Entscheidend ist das Konzept, das sich hier ausdrückt – und das offenkundig im Kern weit westlicher geprägt ist als Donald Trumps „Art of Deal“.
Der Staat ist ganz sicher nicht dazu da, seine Bürger zum Glück zu zwingen, denn dazu bräuchte er ja eine Definition von Glück, also eine Ideologie. Es geht auch nicht darum, dem Einzelnen alle Sorgen seiner Existenz abzunehmen, so wie es sich manche linke Konzepte umfassender Staatsfürsorge so gern ausmalen. Diese Fürsorgekonzepte klingen zwar großzügig gegenüber dem Bürger, sind aber letztlich auch nur Steuerungsinstrumente von oben verordneter Glücksideen. Nein, der Staat soll den Bürger nicht mit Glück versorgen, sondern ihn in die Möglichkeit versetzen, selbst nach Glück zu streben. Erleichterung, Spielregeln, Anreize – daraus ist ein schlüssiger politischer Dreiklang zu komponieren. Deals als politisches Modell, das klingt rationell. Aber es ist nicht rational.