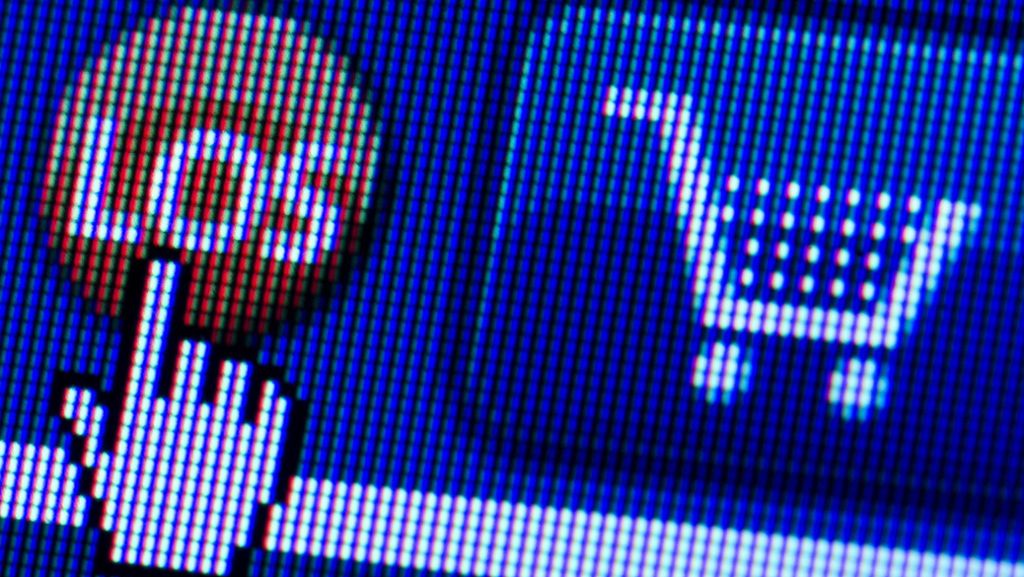Wer ein Handy kauft, erwartet in der Regel, dass jeder den gleichen Preis für das Gerät zahlen muss. Technisch lässt sich das mit personalisierten Preissetzungen umgehen. Zahlen deshalb Menschen, die etwa in teureren Gegenden wohnen als andere, mehr Geld für das gleiche Produkt?
Stuttgart - Erst kostet die heiß begehrte Armbanduhr im Internet 200 Euro, einen Tag später 180 Euro und kaum ist eine Stunde verstrichen, sollen 230 Euro bezahlt werden: Dynamische, meist von Algorithmen festgelegte Preissetzungen bestimmen Händler- und Dienstleistungsangebote schon lange – sowohl analog an der Tankstelle, als auch digital beim nächsten Online-Shop.
Pikanter wird die Situation, wenn es um sogenanntes „personalized pricing“, zu deutsch personalisierte Preissetzungen, geht. Die Theorie: Möchte ein Kunde über sein neustes Apple-Handy ein bestimmtes Produkt kaufen, zahlt er für das gleiche Angebot mehr, als jemand, der ein veraltetes Android-Smartphone für den Kauf benutzt.
„Nach vielen Gesprächen mit Fachleuten und Branchenexperten sehen wir, dass die Möglichkeit für so etwas besteht – die Technik gibt es“, sagt Lars Schmidtke, Referent in der Verbraucherzentrale Brandenburg (vzbb). Bereits Ende 2018 veröffentlichte die vzbb allerdings eine Studie, nach der „die wenigsten Online-Händler“ individuelle Preise für ihre Kunden festlegen würden. In der anschließenden Analyse fanden sich kaum echte Grundlagen, die personalized pricing bei Online-Händlern belegen würden. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich die Händler noch nicht trauen“, sagt Schmidtke. Vorbehalte, die Technologie einzusetzen, und bei Bekanntwerden potenzielle Kunden zu verprellen, seien noch hoch. Denn wer würde es schon gutheißen, wenn die Person neben sich einen billigeren Preis für ein Produkt zahlen darf, nur weil sie ein günstigeres Smartphone besitzt.
Vom aktiven und passiven Weg
Schmidtke geht allerdings davon aus, dass personalized pricing für Online-Händler ein „sehr großes Optimierungspotenzial“ biete und deswegen in unbestimmter Zukunft vermehrt zum Einsatz kommen werde. In Stuttgart hilft beispielsweise die E-Commerce Agentur D-I-S ihren Kunden „bei der Realisierung und Betreuung einer Onlineshop-Lösung“, wie es auf der Homepage des Unternehmens heißt.
Auf Nachfrage, ob personalized pricing bei ihnen ein Thema sei, sagt Markus Wurster, Leiter der Entwicklung bei D-I-S: „Von personenbezogenen Preisen raten wir ab.“ Es könne aber sein, dass in sehr wenigen Fällen Anfragen von Kunden bezüglich personalized pricing eingehen würden.
Wurster betont jedoch: „Wir stehen nicht hinter dem Konzept.“ Auch er argumentiert mit einem schlechten Ruf für den Anbieter, wenn diese Methode zur Preissetzung verwendet und an die Öffentlichkeit gelangen würde. D-I-S rate ihren Kunden eher zu Gutschein- und Bonusprogrammen, wenn es um personalisierte Preise geht.
Diesen passiveren Weg wählen laut Schmidtke vom vzbb viele Anbieter. „Bei Booking.com gibt es zum Beispiel Levels. Wenn Sie zehn Mal buchen, bekommen Sie 10 Prozent Rabatt und so geht das weiter.“ Auch bei Abo-Diensten, wie zum Beispiel Netflix, würden Unternehmen treuen Kunden, die ihr Abonnement kündigen wollen, eine Preissenkung für die kommenden Monate vorschlagen.
Darstellungsformen können ausschlaggebend sein
„Wir wissen, dass Big Data ein hohes Gut für die Händler ist“, sagt auch eine Sprecherin des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel. „Individuell angepasste Preise, zum Beispiel zur Neukundengewinnung oder Kundenbindung gab es schon immer.“ Dabei gebe es keinen Unterschied zwischen dem stationären Handel und dem Onlinehandel.
Mindestens eine Besonderheit besteht bei Internetanbietern aber doch: „Was wir häufig festgestellt haben, ist, dass es eine unterschiedliche Preiswahrnehmung gibt, je nachdem, wie eine Seite aufgebaut ist“, sagt Schmidtke. Wenn ein Produkt auf dem Handy 7 Euro, auf dem Laptop aber 9 Euro koste, könne das daran liegen, dass am Handy nicht genau die gleiche Darstellung des Shops vorhanden ist, wie auf dem Laptop. Beispielsweise werde ein Produkt vom Händler in verschiedenen Farben angeboten. Der Handy-Nutzer sehe aufgrund der für das kleinere Display angepassten Darstellung nur die eine teurere Farbe, während auf dem Laptop-Bildschirm alle Farben angezeigt werden. So entstehe der Eindruck, das Produkt würde auf dem Laptop mehr kosten.
Angewandt werde personalized pricing, so Lars Schmidtke von der Verbraucherzentrale, bislang vor allem zwischen Unternehmen: „Dort wird dann beschönigend von Preisoptimierung über die Käufersituation gesprochen.“
Was lässt sich dagegen tun?
Preislich seien die erforderlichen Technologien für die Umsetzung von personalized pricing auch in Bezug auf einzelne Kunden für so gut wie jedes Unternehmen zu stemmen. Explizit könnten Internetanbieter somit etwa Preise nach iOS- und Android-Geräten filtern. Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg fasst das Gebiet, über das personalisierte Preise zustande kommen können, noch weiter: „Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Standort mittlerweile bis auf das Stadtviertel – ob wohlhabend oder nicht – heruntergebrochen werden kann.“
Auch der Nutzer eines Safari-Browsers würde potenziell preisgeben, dass er vermutlich ein Apple-Produkt besitzt und dem User einer veralteten Windows-Version fehlt mit hoher Wahrscheinlichkeit das Geld für eine Aufrüstung. Dies könnten sich Händler bei der Preisbildung zu Nutze machen. Um sich gegen personalisierte Preissetzungen zu schützen, empfiehlt Buttler unter anderem, Online-Shops nicht mit dem registrierten Benutzerkonto zu durchstöbern. Außerdem sollten Cookies, also Tracking-Daten, regelmäßig gelöscht und gegebenenfalls auf VPN-Dienste zurückgegriffen werden. Letztere verbergen die IP-Adresse des Nutzers im Internet und erlauben so anonymes Surfen.