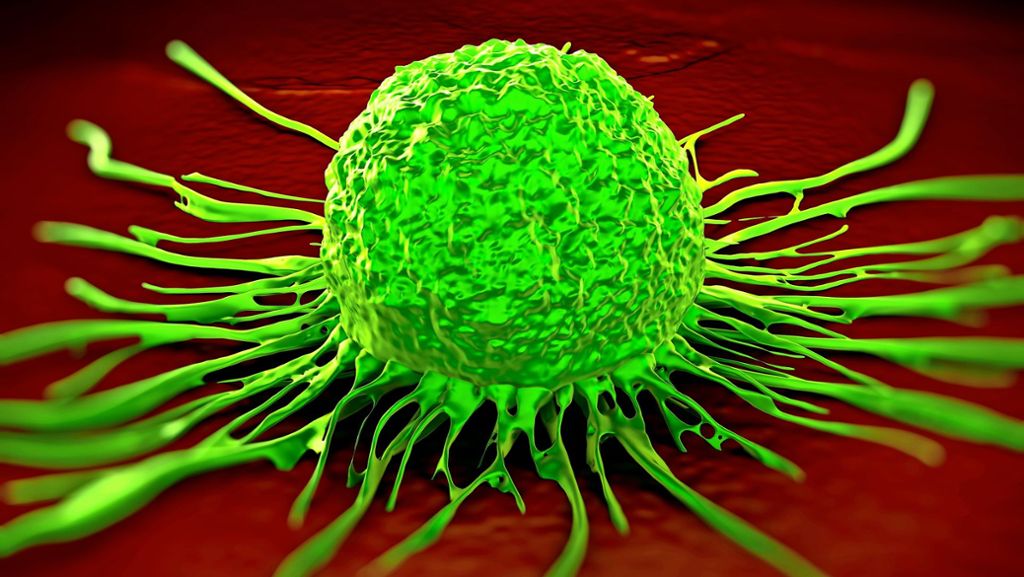Der Heidelberger Mediziner Anthony Ho berichtet im Mercedes-Benz-Museum über die Stammzellforschung zwischen Hoffnung und Realität. Bei der Krebstherapie könnten die sogenannten CAR-T-Zellen völlig neue Möglichkeiten eröffnen.
Stuttgart - Die Erwartungen an die medizinische Forschung sind groß: Künftig könnten womöglich neue Organe aus dem 3-D-Drucker kommen und künstliche Hautpartien in Zellkulturen heranreifen und auf Menschen transplantiert werden. Zudem lassen neue Behandlungsansätze die Hoffnung keimen, dass auch aussichtslose, also austherapierte Krebspatienten erfolgreich behandelt werden könnten.
Das noch neue Forschungsfeld der Ärzte, die sogenannte regenerative Medizin, hat das Ziel, marode Zellen, Gewebeteile und sogar ganze Organe wieder funktionstüchtig zu machen – entweder indem man biologischen Ersatz züchtet und implantiert oder indem man körpereigene Regenerations- und Reparaturprozesse anregt.
Der Mensch – ein biologischer Baukasten?
„Der Treiber hinter solchen Entwicklungen ist die Stammzellforschung“, betont Anthony Ho, der Ärztliche Direktor der Medizinischen Klinik V der Universität Heidelberg. Aber erfüllten sich solche Versprechungen auch in der Praxis? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Vortrags im Mercedes-Benz-Museum, zu dem die Daimler-und-Benz-Stiftung den Spezialisten für Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie eingeladen hatte. Entsprechend lautete das Thema, das sich gut in die Reihe „Dialog im Museum“ einfügte: „Ist der Mensch ein biologischer Baukasten? Stammzellforschung zwischen Versprechung und Erfüllung“.
Als langjähriges Mitglied der Zentralen Ethikkommission für Stammzellforschung des Bundestags verfolgt Ho die Debatte um dieses auch ethisch wie politisch nicht immer einfache Forschungsgebiet aus erster Hand. So konnte der Mediziner in seinem Vortrag einen weiten Bogen schlagen: von der frühen medizinischen Stammzellforschung – sie begann schon vor mehr als 50 Jahren – bis hin zu den jüngsten Erfolgen der Immuntherapie bei der Bekämpfung von Krebs.
1985 erste Transplantation von Blutstammzellen
Dabei erinnert Ho an die erste Knochenmarktransplantation im Jahr 1957, die der amerikanische Chemiker und Mediziner Edward Thomas durchführte – 1990 wurde er dann endlich mit dem Medizinnobelpreis geehrt. Bei einer solchen Transplantation leisten Stammzellen den entscheidenden Beitrag zum Therapieerfolg bei bestimmten Krebsarten.
Am Beispiel der Blutstammzellen erläutert Ho dann, wie lange es von der Erkenntnis bis zur praktischen Anwendung dauert: Erstmalig wurden die Blutstammzellen 1961 nachgewiesen. Anschließend dauerte es bis 1985, bis Heidelberger Mediziner die erste Blutstammzell-Transplantation bei einem Patienten vornahmen. Auch Anthony Ho war an dieser Pioniertat beteiligt. Der Patient hatte einen Lymphdrüsenkrebs, eine Knochenmarktransplantation kam wegen einer Anomalie des Knochenmarks nicht infrage. Nach der Blutstammzell-Transplantation habe sich der Mann in Rekordzeit erholt, sagt Ho – und demonstriert mit einem aktuellen Foto, dass es dem ehemalig Todkranken auch noch heute gut geht.
Viel Begeisterung – und Hoffnung – löste dann 1998 die Entdeckung der humanen embryonalen Stammzellen aus. Mit Tricks könne man „aus einem alten Sack wieder einen jungen Hüpfer machen“, schildert Ho anschaulich die medizinische Vorgehensweise. Dann kamen 2007 die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen, die, wie es Ho formuliert, „alles können außer Sex“ – weil sich daraus keine Keimzellen ableiten lassen.
Alleskönner aus der Petrischale
Diese Alleskönner haben vielfältige Hoffnungen geweckt, etwa auf einen „Organersatz aus der Petrischale“. So könne man bereits Minidärme und andere sogenannte Organoide im Labor herstellen, berichtet Ho. Doch er lässt auch keinen Zweifel daran, dass noch keine Erkrankung durch diese Zellen geheilt wurde, auch wenn die Ansätze sehr erfolgversprechend seien. Auch beim Organersatz mahnt Ho zur Geduld: „Wir sind noch weit davon entfernt, Organe aus embryonalen Stammzellen zu produzieren und zu implantieren.“
Und dann kommt der Heidelberger Mediziner auf eine neue Entwicklung in der Immuntherapie zu sprechen, bei der körpereigene Abwehrkräfte zur Bekämpfung beispielsweise von Krebszellen eingesetzt werden. Passend zu seinem Vortrag im Automuseum handele es sich dabei um die CAR-T-Zellen, meint Ho – und ergänzt, dass ein „CAR-Race for the CAR-T-Cells“ entbrannt sei. Die Abkürzung steht für Chimeric Antigen Receptor, die dritte CAR-Generation wurde im Jahr 2009 etabliert.
Agressive Bekämpfung von Krebszellen
„Damit werden die körpereigenen Polizisten mit einem Maschinengewehr ausgestattet und so zu Serienkillern“, beschreibt Ho sehr anschaulich, was bei dieser Therapie im Körper geschieht. Konkret bedeutet dies, dass die natürlichen Abwehrzellen des Körpers, die T-Zellen, mit gentechnischer Hilfe so aufgerüstet werden, dass sie bis dahin gut getarnte Krebszellen erkennen können.
Wenn die solchermaßen veränderten T-Zellen im Labor vermehrt und anschließend dem Patienten wieder zurückgegeben werden, können sie die Krebszellen sehr aggressiv bekämpfen. Bisher wird auf diesem Feld vor allem in den USA geforscht, aber auch in Deutschland laufen verschiedene Forschungsvorhaben, darunter in Heidelberg.
Trotz erster beeindruckender Erfolge sei diese Therapie aber noch „sehr optimierungsbedürftig“, sagt Ho – und damit noch lange nicht für Routinetherapien geeignet. Dabei sei, so betont er am Schluss, „Erfolg nur möglich durch vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Grundlagen- und klinischer Forschung“. Und er fügt an: „Das Prinzip des Handelns zu verstehen ist wichtiger als das Handeln selbst.“