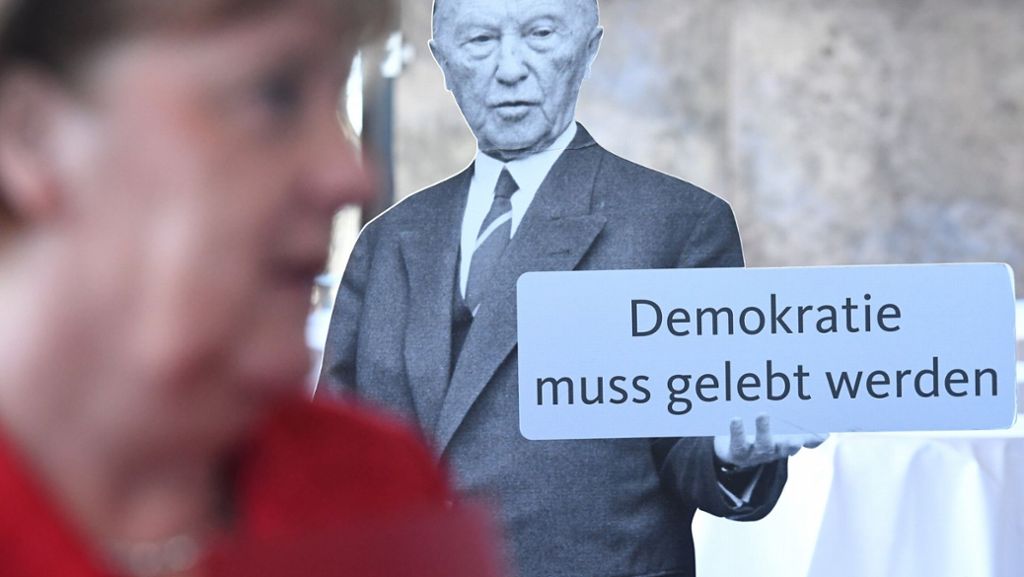Der Begriff „Volk“ wird in diesem Bundestagswahlkampf eine größere Rolle spielen. Unsere Autorin Katja Bauer erinnert an die Pflicht der Politiker, sich um alle im Land lebenden Bürger zu kümmern.
Stuttgart - Angela Merkel hat eine nahezu betonungsfreie Art, Aussagen zu schwierigen Positionen zu formulieren. Neulich zum Beispiel: „Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt“, sagte die Kanzlerin im Februar in Stralsund in einem Duktus, als würde sie morgens beim Frühstück um die Kaffeesahne bitten.
Der Satz fiel vor Parteifreunden in einer großen Runde, der Termin markiert den offiziellen Beginn eines Wahljahres. Es wäre für Merkel möglich und einfacher, an dieser Stelle andere Dinge zu sagen und dieses Feld zu meiden. Warum hat sie es getan? Ein Teil der Antwort steckt im Satz davor. Es gebe, so sagte Merkel, „keinerlei Rechtfertigung, dass sich kleine Gruppen aus unserer Gesellschaft anmaßen zu definieren, wer das Volk ist“.
Populisten nehmen für sich in Anspruch, diejenigen zu sein, die „dem Volk“ am besten aufs Maul schauen, woraus sie das Recht ableiten, dann stellvertretend für das Volk zu sprechen, auch wenn sie alles andere als eine Mehrheit dafür haben. Man muss jedoch kein Populist sein, um zu erkennen, welche Themen gerade Funken schlagen. Auch Merkel hat verstanden, dass in diesem Wahlkampf der Begriff Volk mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rolle spielen wird. Nachdem die Wutbürger von Pegida den einst gegen eine Diktatur gerichteten Ruf der Wende-Montagsdemonstranten gekapert haben, versuchen nun AfD-Granden Begriffe wie „völkisch“ mit dem Dampfstrahl von der finstersten deutschen Geschichte zu reinigen. Sie will die Partei offenbar am liebsten vergessen machen.
Die Rechten besetzen eine Leerstelle
Die auf Abstammung fußende Volksidee ist Grundlage für Abschottungspolitik, folglich enthält das Wahlprogramm der Nationalisten mehr als nur einen veritablen Blut-und-Boden-Satz: „Wir wollen das Land unserer Väter und Mütter nicht irgendjemandem hinterlassen, der dieses Erbe verschleudert oder ausplündert, sondern unseren Nachkommen (. . .).“ Deshalb fordert die Partei den „Erhalt des Staatsvolks“ als Ziel ins Grundgesetz zu schreiben.
Es gibt aber noch einen Grund für Merkel, sich dieses Themas zu bemächtigen: Die Debatte tut not. Dass sich überhaupt jemand mit der Frage beschäftigt, wer zum Volk gehört, ist weniger die Folge der gestiegenen Flüchtlingszahlen, sondern eines Versäumnisses. Die Rechten besetzen eine Leerstelle: Dort, wo sich die Union schon seit Jahrzehnten davor drückt, die Realität eines Einwanderungslandes auszusprechen und politisch zu gestalten – dort, wo Grüne, Linke und SPD sich ewig scheuten zuzugeben, dass eine Einwanderungsgesellschaft sich auch hart mit der Frage auseinandersetzen muss, wie sie ihre Identität denn definiert.
Verpflichtung, den Volksbegriff weit zu fassen
Für Merkel allerdings ist aktuell eine Sache interessant: Das Echo auf ihre recht offene Definition von Volk blieb eher leise. Lediglich im sehr konservativen eigenen Lager und rechts davon erntete die Kanzlerin Kritik – im Wesentlichen dieselbe, die ihr seit Sommer 2015 ohnehin entgegenschlägt. Dabei betritt die Kanzlerin heikles Terrain. Und sie lässt mit ihrem Satz eine Menge offen. Man kann sich schon fragen, ob mit der Formulierung nun das Volk der Staatsbürger gemeint ist, die berechtigt sind zu wählen – und ob diese Gruppe in den Augen Merkels deckungsgleich ist mit dem im Grundgesetz benannten Volk, von dem „alle Gewalt ausgeht“. Ist also nur der Wähler Volk? Oder alle? Hätte Merkel von der Bevölkerung sprechen wollen, hätte sie es getan.
Und so ist der Satz dann doch als ein Hinweis zu verstehen: Es gibt die Staatsbürger, den Souverän, der wählt. Die Gewählten aber haben eine Verpflichtung, den Volksbegriff weiter zu fassen. Jeder mit Regierungsverantwortung betraute Politiker – und ebenso jeder Parlamentarier, auch jeder in der Opposition – ist mit seinem Handeln einer anderen Gruppe verpflichtet: nämlich jedem Menschen, der hier in diesem Lande lebt.