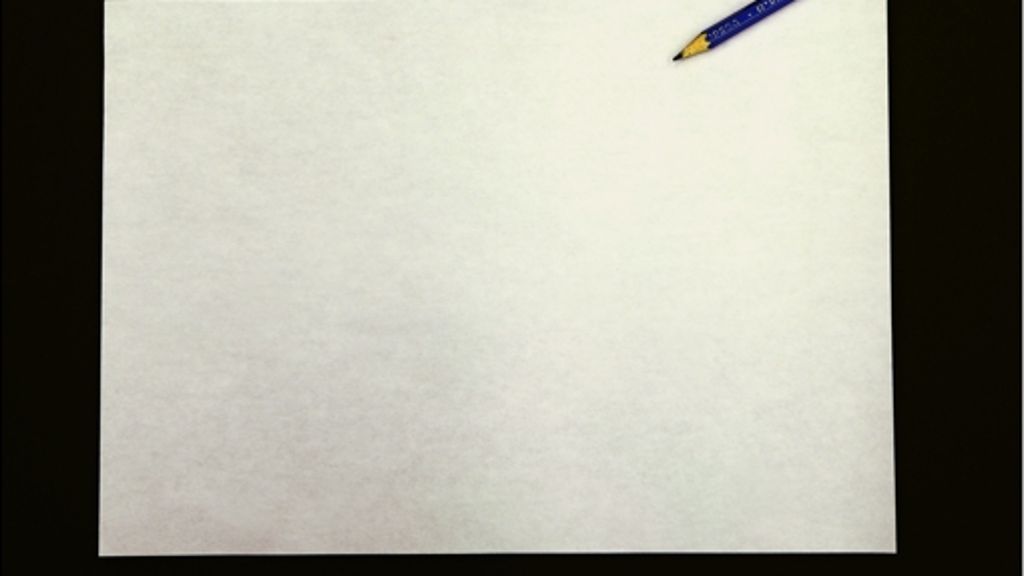Was ist es, das den Leser dazu bringt, in die Welt eines Romans einzutreten? Wie stimmt der Autor die Tonlage an, wie viel deutet er an, was bleibt zunächst ungesagt? Der Schriftsteller und StZ-Autor Rainer Wochele nimmt das Anfangen unter die Lupe.
Stuttgart - „Ganz am Anfang, wenn alles noch nicht da ist, andererseits aber doch schon da ist, irgendwie und irgendwo im Kopf ist, nur noch nicht auf dem Papier ist oder im PC, geschweige denn gedruckt vor dir liegt“, so habe ich einmal in einem Essay über literarische Recherche geschrieben, „wenn es zwar bereits in den teils stockdunklen, teils hell erleuchteten Produktionshallen der Fantasie lagert, jedoch noch nicht in der Seele der Wörter, im Charakter der Sätze steckt – ganz am Anfang ist alles nur ein großes Versprechen.
Und es ist ein großes Glück.
Es ist ein großes Versprechen auf das, was sein könnte. (. . .) Du stehst am Roulettetisch im Casino der Literatur und schickst dich an, alle deine Jetons, buchstäblich dein ganzes ‚Vermögen‘ zu setzen auf Farbe und Zahl. Du kannst verlieren. Alles. Du kannst gewinnen. Alles.“ So habe ich in diesem Essay damals geschrieben.
Ja, natürlich. Du kannst gewinnen. Alles. Aber dafür musst du erst einmal anfangen. Alles. Musst beginnen. Du musst die Leere des weißen Blattes oder das leere Grau des Bildschirms überwinden, indem du einen ersten Satz hinschreibst, einen ersten Absatz. Doch wie soll er aussehen, dieser erste Satz, dieser erste Absatz?
Martin Walser setzt auf die Anfangsstimmung
„Ich möchte nie begründen müssen, warum ein Satz als erster Satz taugt“, so hat Martin Walser seine „Erfahrungen mit ersten Sätzen“ einmal geschildert. Und er hat hinzugefügt: „Ich finde es schon einmal günstig, wenn der erste Satz nicht nur ein Satz ist, der an und für sich bestehen kann, sondern wenn er auch noch vom Anfang handelt.“ Er, Walser, möchte keinen solchen Satz suchen oder basteln müssen. Er müsse sich als Ausdruck der Anfangsstimmung einstellen. „Ich glaube, für den ersten Satz ist der Autor noch weniger verantwortlich als für alle weiteren Sätze.“ Denn man könne Sätze nicht machen, man könne sie nur entgegennehmen oder ablehnen. Und Walser stellt sich und seinen Kollegen Romanschriftstellern an diesem Punkt gleichsam einen Persilschein aus, ein kühnes, ja verwegenes Unbedenklichkeitszeugnis: „Ich glaube, für den ersten Satz ist der Autor noch weniger verantwortlich als für alle weiteren Sätze.“
Nun ja, lässt sich da denn doch einwenden, das klingt sehr nach dem Kuss der Muse, der dem Autor in einem Zustand des Ausgeblendetseins zuteilwird, worauf er gleichsam blindlings zu schaffen beginnt – eine Haltung mithin, wie sie gängiger und auch althergebrachter bürgerlicher Vorstellung vom Genie eigen ist, sofern Martin Walser, man kann bei ihm da nie sicher sein, hier nicht kokettes Argumentationsspiel treibt. Denn er weiß sehr wohl, Kunstausübung hat immer auch mit Können zu tun, mit Kenntnis, mit Handwerk, das zu beherrschen ist.
Der Autor muss den Leser fesseln – leicht gesagt . . .
Hat ein Romanschriftsteller seine Hausaufgaben gemacht, das heißt, kennt er seinen Stoff in- und auswendig, weiß er genügend über seine Figuren, über die Hauptfigur, über den Gegenspieler, kennt er den Anfang, den Schluss und zumindest die anderen wichtigen Stationen seiner Ge-schichte, und setzt er sich sodann hin, um mit dem Schreiben zu beginnen, und bleibt er dabei so unverkrampft, wie ihm dies nur möglich ist, und hört er dabei in sich hinein, so mag er gewiss einen ersten Satz, einen zweiten Satz vernehmen, die da auf ihn zukommen und sagen: Nimm doch mich. Ich hab die Kraft und die Energie und die Stimme, um deinen Leser zu packen.
Am Anfang müsse der Autor den Leser fesseln, hat der Schriftsteller Dieter Wellershoff, der viele kluge Sachen über das Handwerk des Schreibens gesagt hat, in seinem Buch „Der Roman und die Erfahrbarkeit der Welt“ geschrieben. Gleich mit dem ersten Satz, so Wellershoff weiter, müsse der Autor deutlich machen, dass er seiner Sache sicher sei und dem Leser das Gefühl geben, es lohne sich, den langen Weg durch eine fremde Erfahrungs- und Fantasiewelt anzutreten. „Die eigene Faszination muss zu spüren sein, in der allein alle Überzeugungskraft steckt.“
Der Leser braucht ganz schön Energie
Diese Überzeugungskraft wäre also das süße Lockmittel, um den Leser rasch in den Roman hineinzuziehen. Doch Martin Walser fragt auch da hintersinnig, ob man denn gleich drin sein müsse, in einem Roman. „Überhaupt nicht“, antwortet Walser sich selbst. „Je dicker ein Roman ist, desto weniger kann man von ihm verlangen, dass man schon auf der ersten Seite in ihn hineinkommt.“
Betrachtet man den Vorgang des Lesens, zumal des Lesens der ersten Seiten eines Romans, so muss man feststellen, dass der Leser, die Leserin zu Anfang ja Energie aufzubringen hat, um dranzubleiben, ja, sich vielleicht sogar zwingen muss weiterzulesen. Bis so viel Faszination wachgekitzelt ist, dass keine Willenskraft mehr aufgewendet werden muss, um lesend Satz auf Satz folgen zu lassen. „Der Roman hat ein Interesse geweckt“, so beschreibt Martin Walser diesen Zustand, „wir können mit dem Buch etwas anfangen. Das heißt, wir können unser eigenes Leben, unsere eigenen Schwierigkeiten mit diesem Buch durchspielen.“
Handwerker oder Geniedichter?
Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil etwa misst dem Schreibvorgang insgesamt durchaus Konkretes zu. „Die geistige Arbeit des Schriftstellers“, sagt Ortheil, „diese Vernetzung von Eindrücken, dient der Aufgabe, eine Kultur der Intensität, des Schaffens und der Vergleiches zu bauen.“ Zu „bauen“, sagt Ortheil, also zu machen, nach Plan herzustellen. Was allemal Bewusstheit voraussetzt. Demgegenüber sieht sich Walser als Ferngesteuerten, als einen von der Macht der Sprache Dirigierten, wenn er sagt, man könne sich ja alles vornehmen, aber was man dann schreiben kann, „kann man nicht einmal selbst bestimmen. Man muss es nehmen, wie es kommt. Es gibt wahrscheinlich keine passivere Tätigkeit als das Schreiben.“
Ortheils Autorenposition sieht da ganz anders aus: „. . . der Erzähler hat eine unübersichtliche Fülle von Daten, von Informationen gesammelt. Kann man ihnen eine bestimmte Struktur geben, und welches Ziel verbindet man damit?“ Ist die Walser’sche Autorenposition nicht doch ein bisschen kokett? Geht er den Verlockungen und der Eigendynamik der Sprache bei solchem Argumentationsspiel nicht doch mit Lust auf den Leim? Ist die Standortbestimmung Ortheils demgegenüber nicht doch etwas trockenmechanistisch, ingenieurhaft beinahe?
Übersichtlich, persönlich und mit Leerstellen
Betrachtet man einmal eine Reihe von Romananfängen, so kann man durchaus einige Kriterien erkennen, die sie auszeichnen. Rein formal wird man feststellen, dass die ersten Absätze von Romanen meist nicht länger als sechs bis acht Zeilen lang sind – von wenigen Ausnahmen, wie etwa Thomas Mann oder Thomas Bernhard, abgesehen. Und die Romananfänge, die ersten Absätze, zeigen uns meist dies: da ist ein Mensch in Bewegung, ohne dass wir erführen, wohin er sich bewegt. Wir bekommen gesagt, ob es sich um eine Frau oder um einen Mann handelt. Vielleicht teilt der erste Absatz noch mit, wie alt dieser Mann, diese Frau ist, die wir da zu Beginn sehen. Und – sie, jener Mann, jene Frau, auf die der erste Satz, der erste Absatz den Scheinwerfer richtet, sie haben eine Absicht, streben auf ein Ziel zu, ohne dass uns gesagt werden würde, worin dieses Ziel besteht.
Und genau dies ist das Geheimnis von guten Romananfängen (auch von guten Filmen mit künstlerischem Anspruch im Übrigen). Sie stellen eine raffinierte Mischung dar aus Informationsgaben und aus Informationsentzug. Das, was an Informationen gegeben wird, macht uns neugierig, stachelt unsere Fantasie an. Den Mangel an Informationen wollen wir beseitigen, indem wir weiterlesen. Der Mensch ist nun einmal so gebaut, dass er einen Zustand von Informationsmangel, von Nichtwissen, von Unerklärtem, nicht gut aushalten kann und sofort bestrebt ist, diesen Zustand zu beseitigen. Diese Kraft machen sich gute Romananfänge zunutze.
Der Germanist Wolfgang Iser hat dieses Wirkgeflecht einmal so beschrieben: „Erst die Leerstellen gewähren einen Anteil am Mitvollzug und an der Sinnkonstruktion des Geschehens. Räumt der Text diese Chance ein, so wird der Leser die von ihm komponierte Intention für wahrscheinlich halten. Denn wir sind geneigt, das von uns Gemachte als wirklich zu empfinden.“
Faszination ist wichtiger als Perfektion
All dies bezieht sich zuerst einmal auf die Handlung einer Geschichte, eines Romans, auf die Aktion, auf das, was die Figur tut, die uns da zu Anfang vor Augen gestellt wird. Aber ebenso wichtig ist der Klang, den der Schriftsteller gleich mit dem ersten Satz anschlägt, die Erzählperspektive, die Sprachmelodie, die Erzählmusik. Dieter Wellershoff sagt es so: „Die Handlung, die Geschichte, ist eine starke dynamische Kraft. Doch kann das Weitertreibende auch eine Sichtweise und ein Tonfall sein.“
Erste Sätze, erste Absätze und dann auch die erste Seite eines Romans müssen nicht perfekt sein im Sinne eines ausziselierten, fein ausgepinselten Textes. Sie sollten hingegen eine starke Erzählströmung darstellen, eine kraftvolle Erzählstimme hören lassen, im Sinne einer entschlossenen Darbietung aus Fakten, Einzelheiten, Details und, ebenso wichtig, den Lücken, Leerstellen in solcher Anfangspassage, dem Unaufgelösten und dem noch nicht Bekannten zwischen diesen Details.
Der Vertrag zwischen Leser und Autor
Zu Beginn schließt der Schriftsteller einen Vertrag mit dem Leser. Dieser Vertrag lautet: Hör zu, ich habe dir etwas Wichtiges, Spannendes, Unerhörtes, Aufregendes zu erzählen. Und ich kann das, ich der Autor, der Schriftsteller. Ich weiß, wie man so etwas macht. Diese Gewissheit muss sich mitteilen. Dann wird der Leser gleichsam sagen: Okay, ich unterschreibe den Vertrag, ich bin dabei, komm, lass uns losmarschieren, hinein in deine Welt, ich geh mit. Ich spendiere dir, dem Autor, ein Stück meiner Lebenszeit, indem ich höre, was du zu sagen hast. „Immer wenn sie dieses blaue, himmelblaue Weltumarmungsgefühl in sich spürte, musste sie jemandem zum Lachen bringen.
Und zwar sofort.
Nur – da war niemand.
In der Regalgasse des Supermarkts, in der sie sich befand, war niemand, den man mit einer komischen Bemerkung, einem zugerufenem Scherzwort, einer humorvollen Begrüßung hätte zum Lachen bringen können . . .“
So beginnt mein Roman „Der General und der Clown“, in dem es um den Völkermord 1994 in Ruanda geht, und man gestatte mir hier, ausnahmsweise von eigener Arbeit und Erfahrung zu sprechen. – Ja, himmelblaues Weltumarmungsgefühl, was ist denn das? Und warum muss und will „sie“ jemanden zum Lachen bringen. Immerhin, wir erfahren, dass da eine Frau im Supermarkt steht, von eigenartigen Gefühlen gepackt wird und eine Absicht hat.
Oder, bitte, ein anderer Anfang:
„Warum?
Warum wollte sich Richard Recknagel töten?
Die Welt ist schön. Man kann fliegen. Die Welt ist schön. Man kann fliegen. Kann Frauen lieben. Kann gut essen. Bier trinken. Schnaps trinken. Man kann fliegen.“
So beginnt meine Novelle „Der Flieger“, in der es um einen ungewöhnlichen Piloten geht, der sich schließlich umbringt. Und wieder: eine Person wird vorgestellt, ein Mann namens Richard Recknagel – der eine unerhörte Absicht hat, nämlich, sich zu töten. Aber warum denn, bitte, warum denn? Die Welt ist doch schön . . .
Der gemeinsame Flug in ein schönes Land
Diese Anfangspassage wirft mit der Absicht, dass sich da einer umbringen will, obwohl die Welt doch schön ist und man auf dieser schönen Welt eine Reihe von erfreulichen Dingen tun kann, eine ungeheure Frage auf, die aber nicht beantwortet wird. Oder vielleicht doch? Der Text schürt die Erwartung, dass wir, wenn wir nur weiterlesen, die Antwort auf diese Frage vielleicht finden werden.Anfänge – oh ja, sie können den Schriftsteller überraschen, faszinieren, packen. Und wenn sie dies tun, werden sie auch den Leser in Bann schlagen. Und beide, Autor und Leser werden dann angstfrei und erwartungsvoll starten zu einem herrlichen Flug ins Land einer Geschichte, die gemacht ist aus nichts anderem als aus ein paar Zeichen, die wir Buchstaben nennen. Einer Geschichte, die ein Spiegel sein kann unserer harten, harschen, hoffnungsvollen und oft wunderbaren Wirklichkeit. Aber der Start des Fluges, der Anfang, er muss gelingen, die Geschichte muss hinaufkommen in die Luftströmungen und in die Thermik der Fantasie, der Steuerknüppel und die Seitenruder müssen sachgerecht und kunstvoll bedient werden, so dass das Erzählte Flügel bekommt.
„Natürlich muss jedes künstlerische Werk in der Konzeption, wenn diese nämlich jenen Punkt erreicht hat, an dem der Künstler mit der Arbeit beginnen kann, eine gewisse Form besitzen“, so hat William Faulkner die schriftstellerischen Handwerksschwierigkeiten des Anfangs und des Anfangens umrissen. Und er hat hinzugefügt, das Problem bestehe für den Künstler darin, Fantasie und Form miteinander in Einklang zu bringen, „damit zwischen beiden eine Harmonie besteht“.
Rainer Wocheles neuer Roman „Der Katzenkönig“ erscheint im Februar 2015 bei Klöpfer & Meyer.