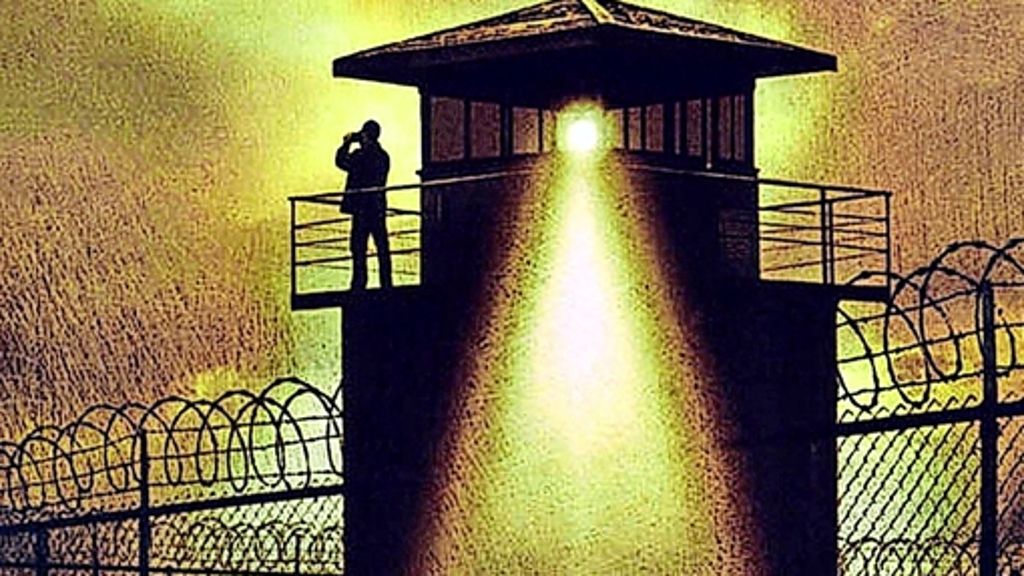US-Serien wie „Breaking Bad“, „Oz“ oder „Treme“ gibt es jede Menge. Manche sind erfolgreicher als andere. Regisseur Christoph Dreher nimmt in seiner Dokumentation „It’s more than TV“ einige dieser Serien unter die Lupe.
Stuttgart - Man hat diesen Satz in den vergangenen Jahren öfter mal gehört und gelesen: „Wir erleben gerade ein neues Goldenes Zeitalter des Fernsehens.“ In der Dokumentation „It’s more than TV“ wird er aber von jemand gesprochen, dem man gerne zuhört und der zu diesem Goldenen Zeitalter etwas beigetragen hat: der Schauspieler Bryan Cranston, der in „Breaking Bad“ die Hauptfigur Walter White spielt, den Highschool-Lehrer, der sich auf den Drogenhandel verlegt.
Der Regisseur der Dokumentation ist Christoph Dreher, der seit 2001 an der Stuttgarter Merz-Akademie eine Professur für Film und Fernsehen innehat. Dreher hat sich früher als viele andere mit den neuen Qualitätsserien aus den USA auseinandergesetzt und deren Macher auch nach Deutschland geholt, um sie zu Nutz und Frommen seiner Studenten über ihre Methoden und Erfahrungen und über die Infrastruktur zu befragen.
Manche Serien sind schon fast totgelobt
Dieser Umstand und der Untertitel der Sendung – „Die neuen US-Serien und ihre Macher“ – könnten leicht die Erwartung wecken, Arte strahle heute Abend um 23.15 Uhr eine Art enzyklopädischen Rundgang durch alles aus, was das US-Fernsehen in den letzten eineinhalb Jahrzehnten an herausragenden Produktionen geliefert hat. Den aber hat Dreher in keinem Moment im Sinn. Er will anhand weniger Beispiele – neben „Breaking Bad“ vor allem „Oz“ und „Treme“ – zeigen, welche kreativen und strukturellen Voraussetzungen gute Serien brauchen.
Bei der Wahl der Beispiele mag mitgespielt haben, dass viele Serien fast schon totgelobt sind. Wenn einer noch einmal „The Sopranos“ oder „The Wire“ preisen will, besteht eine gewisse Gefahr, dass die Leute weghören: „Danke, wissen wir.“
Die in einem Hochsicherheitsgefängnis für Schwerverbrecher spielende Serie „Oz“, 1997 beim Kabelsender HBO gestartet, hat dagegen nicht jeder auf dem Zettel. Dreher sieht in ihr die Initialzündung für das neue Autorenfernsehen, wie er im Vorwort seines Interview- und Aufsatzbandes „Autorenserien – Die Neuerfindung des Fernsehens“ (Merz Akademie) darlegt. Dieses Buch darf man übrigens jedem empfehlen, dessen Ansprüche an TV-Serien von den „Soko-Irgendwo“-Formaten nicht befriedigt werden.
Regeln brechen kann auch zum Erfolg werden
In „It’s more than TV“ darf also zunächst Tom Fontana, der Showrunner von „Oz“, erzählen, wie das damals zuging. Er macht klar, dass der Einstieg ins Besondere auch eine kaufmännische Entscheidung des Senders HBO war. Auf einem Markt, auf dem viele sehr viel finanzkräftigere Anbieter immer neue Produkte gemäß alter, simpler Formeln schufen, lag eine enorme Profilierungschance im Regelbruch. Man suchte nach Dingen, die tabu waren.
„Man kann eigentlich nicht den Protagonisten einer Serie in der ersten Folge umbringen“, erklärt Fontana. „Also haben wir genau das getan.“ Qualitätsserien , so lernen wir von Fontana, von Vince Gilligan („Breaking Bad“) und David Simon („The Wire“) benötigen Sender, die den Mumm haben, kreative Ideen entwickeln und ausgestalten zu lassen, die nicht hie, da und dort furchtsam das Zurückstutzen auf gewohnte Maße verlangen. „Ohne HBO“, sagt Simon, „wäre ich noch immer Journalist und würde Sachbücher schreiben.“ Die Showrunner aber, die verantwortlichen Kreativen, die nach oben gut abgeschirmt sein sollten, müssen wiederum fähig sein, ein Autorenteam zu inspirieren und dessen Ideen aufzunehmen.
Nicht alle Serien werden zum Quotenhit
Dreher schildert aber nur nebenbei Simons Arbeit an „The Wire“. Vor allem geht es ihm um die aktuellere Serie „Treme“, die vom Leben in New Orleans nach dem Hurrikan Katrina erzählt, und zwar am Beispiel der Musikerszene. Hier wird aber auch eine Grenze von Drehers Dokumentation deutlich. Um Zuschauerakzeptanz und Quotendruck kümmert sie sich wenig. Bei Dreher scheint der Optimismus auf, der DVD-Markt, auf dem viele Serien mehr Publikum als bei der Ausstrahlung finden, schaffe schier grenzenlose Freiheit. „Treme“ aber, deren vierte und letzte Staffel nur noch fünf Folgen umfasste, hat kein großes Publikum erreicht, so wenig wie „Hung“ und etliche andere Serien. Auch dieser Markt scheint endlich und von Verdrängungsprozessen geprägt.
Wenn Dreher den Sender AMC, die Heimat von „Breaking Bad“, neben HBO stellt, dann klammert er auch da ein Problem aus. Das Management von AMC hat sich mehrfach heftig in die Produktionen von „Mad Men“ und „The Walking Dead“ eingemischt, nicht zu deren Vorteil. Wie lange das neue Goldene Zeitalter des Fernsehens anhalten wird, ist also unklar. Hoffentlich so lange, dass Christoph Dreher andere Aspekte der Serienproduktion kritisch beleuchten kann, ohne daraus einen Nachruf machen zu müssen.