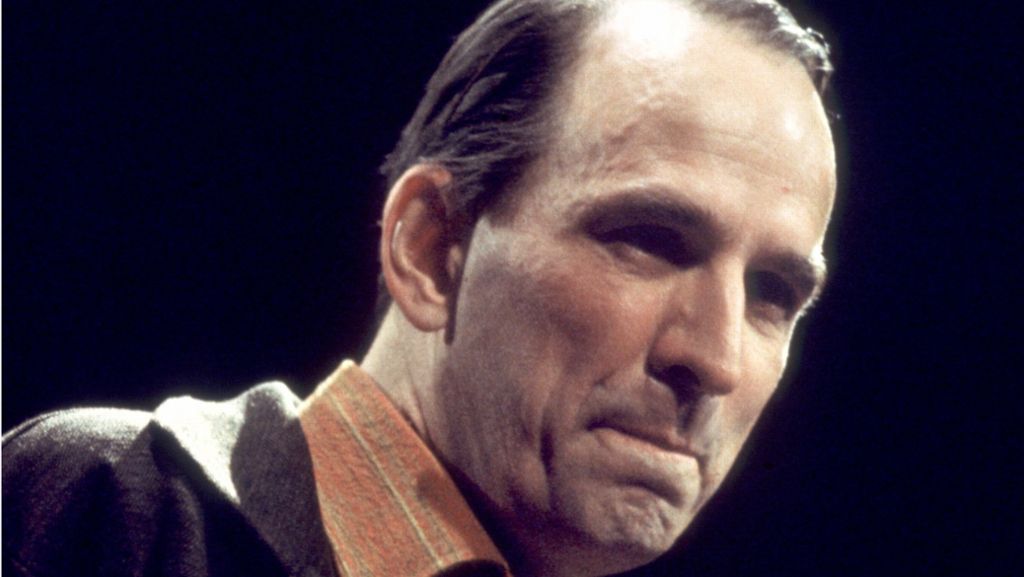Der schwedische Regisseur Ingmar Bergman hat das Kino und unzählige andere Regisseure geprägt, von Woody Allen bis Ang Lee. Doch kann man ihn auch im 21. Jahrhundert noch anschauen? Margarethe von Trotta will das in einem Dokumentarfilm erforschen. Dabei liegt die Antwort so nah!
Stuttgart - Er ist einer der größten Filmregisseure und Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts – der Schwede Ingmar Bergman, an diesem Samstag vor hundert Jahren in Uppsala geboren, vor knapp elf Jahren auf der Ostseeinsel Farö gestorben. Er hat als Nicht-Amerikaner für gleich drei Filme den Oscar gewonnen, ist von den drei großen Filmfestivals Berlin, Venedig und Cannes für sein Lebenswerk geehrt worden; die Franzosen erklärten ihn 1997 gar zum „Besten Regisseur aller Zeiten“ und erfanden dafür einen einmaligen Sonderpreis, die „Palme der Palmen“.
Als die Europäer 1988 versuchten, mit einem eigenen Filmpreis gegen den US-Oscar zu trommeln, ging der allererste „Felix für ein Lebenswerk“ just an Bergman. Sein Einfluss auf andere Regisseure ist immens. Beispielhaft seien so unterschiedliche Typen wie Francois Truffaut, Claude Chabrol, Woody Allen, Ang Lee und Lars von Trier genannt, die alle zu Protokoll gaben, ohne das Vorbild von Ingmar Bergman sei ihr Werk gar nicht zu erfassen.
Ihr Film stand auf Bergmans Liste
Dennoch stellt sich die Frage: Sprechen Ingmar Bergmans Filme auch noch für ein Publikum im 21. Jahrhundert? Oder sind seine großen Filme „Abend der Gaukler“ (1953), „Das Lächeln einer Sommernacht“ (1955), „Das siebente Siegel“ (1957), „Das Schweigen“ (1963) oder „Die Stunde des Wolfs“ (1968) schlicht Vitrinenstücke aus dem großen Filmmuseum, interessant nur noch für jene ganz Verschrobenen und Verrückten, die sich das Werden des Mediums in Gänze erarbeiten wollen (eine Ambition, die selbst unter Filmstudenten längst und strengstens verpönt ist)?
Die deutsche Filmregisseurin Margarethe von Trotta, Jahrgang 1942, hatte nun die Chance, uns diese Frage zu beantworten. Immerhin heißt ihre Doku, die seit Donnerstag im Kino zu sehen ist, „Auf der Suche nach Ingmar Bergman“. Trotta hat einen besonderen Bezug zum Schweden – die Wertschätzung war offenbar wechselseitig: Als Bergman 1994 für das Filmfest in Göteborg elf Filme auswählen sollte, die ihn am meisten beeindruckt haben, stand auf seiner Liste neben dem Erwartbaren von Wilder, Fellini und Kurosawa doch tatsächlich „Die bleierne Zeit“. Als erste Frau überhaupt und im Alter von 39 Jahren hatte Trotta mit ihrer RAF-Milieustudie 1981 die Goldene Palme in Venedig gewonnen.
Ein Film von Eingeweihten für Eingeweihte
Nun also verspricht die mittlerweile 76-Jährige dem geneigten Publikum, das Phänomen Bergman erforschen und begreifbar machen zu wollen. Sie reist dafür in sehr geschmackvollen Klamotten kreuz und quer durch Europa, stiefelt durch Straßen, Ateliers und Wohnzimmer, befragt Witwen und Kinder, Schauspieler und Produzenten, streut auch immer wieder einzelne Filmszenen ein – aber ach, sie fällt natürlich prompt in jene Grube, die sich schon so viele Verehrer geschaufelt haben, die über das Objekt ihrer Verehrung forschen: Sie sprechen als Eingeweihte für die übrigen Eingeweihten, als Jünger für andere Jünger. Wobei: fällt Trotta wirklich aus Versehen in diese Grube? Nein, sie stürzt sich aus Überzeugung mit Hurra hinein.
In diesem Film gibt es keine Chronologie und keine Dramaturgie. Alle Lebensstationen, alle Filme, alle Schicksalsschläge aus dem Leben Bergmans muss man schon vorher kennen. Eigentlich muss man auch die Interviewpartner Trottas alle schon irgendwie von früher kennen. Niemand wird richtig vorgestellt; ab und zu wird sogar auf eine Namenseinblendung verzichtet. Aber klar: alle duzen sich. Das ist so in Schweden. Das ganze Elend des deutschen Arthaus-Kinos wird hier offenbar: Es müssen offenbar nur genügend Fördergremien ihre Summen spendiert haben, dann erübrigt sich jede weitere Frage nach Ziel oder Konzept eines Projektes. Man möchte offenbar in allen Ehren älter werden und dann irgendwann mit seinem Restpublikum gemeinsam, aber in Ehren sterben. Das ist nicht traurig. Das ist schaurig.
Bitte in der langen TV-Fassung!
Also, werte Bergman-Kinokirchengemeinde: schaut auf diesen Film! Und der Rest der Welt, sofern er auf anderen Wegen neugierig geworden ist, besorgt sich aus irgendeiner Netzwelt entweder den TV-Mehrteiler „Szenen einer Ehe“ – an Glanz, Verzückung, Elend und Wahnsinn der bürgerlichen Zweierbeziehung hat sich in den vier Jahrzehnten seit 1973 wirklich nichts geändert; die Schauspielleistungen von Liv Ullmann und Erland Josephson sind überirdisch gut.
Oder man greift (bitte auch in der ausführlichen TV-Fassung) zu „Fanny und Alexander“ von 1982. Wer hier in dieser Kindergeschichte erlebt, wie eng und absolut schlüssig Ingmar Bergman Wirklichkeit und Kunst, Liebe und Hass, Schönheit und Hässlichkeit miteinander zu verstricken vermochte, wie mühelos er den Zuschauer die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion, Sinnlichem und Übersinnlichem überwinden lässt, um ihm schlussendlich nichts weiter mitzugeben als einen großen Psalmgesang auf das Leben in all seiner Fülle und Schrecklichkeit – wer dies fünfeinhalb Stunden lang erlebt hat, der will auch den Rest des schwedischen Zauberers kennenlernen: „Alles kann geschehen, alles ist möglich und wahrscheinlich. Zeit und Raum existieren nicht.“ Was das ist? Das ist das 21. Jahrhundert.