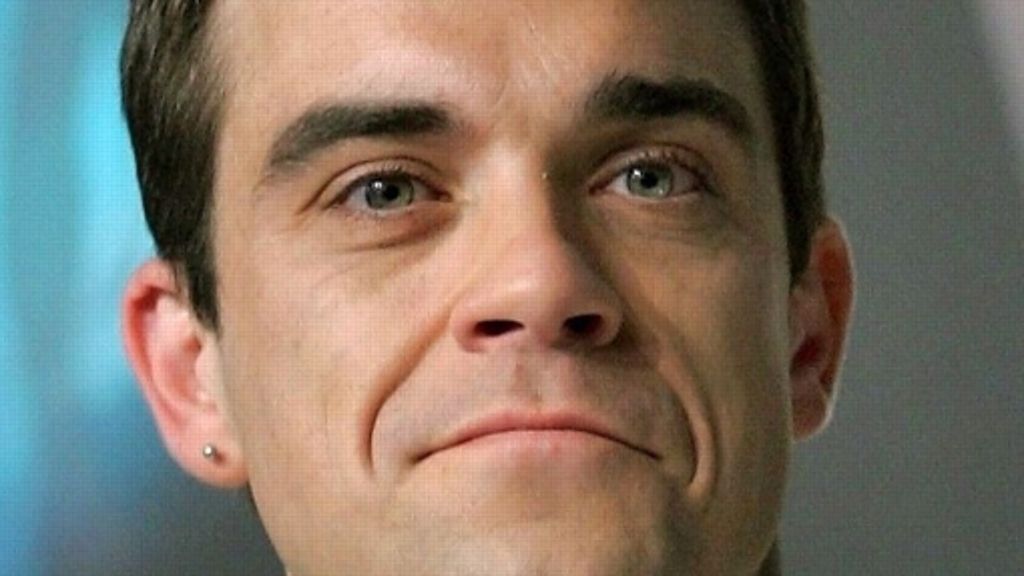Die seelische Krankheit zeigt sich bei Männern anders als bei Frauen. Das ist ein wichtiger Grund, warum Depressionen vor allem bei Männern nach wie vor viel zu selten erkannt werden.
Stuttgart - Stolze 300 Kilometer legte er auf dem Rad zurück – jeden Tag. Doch das reichte nicht, um das Gedankenkarussell im Kopf anzuhalten, das ihn immer weiter trieb. „Ich wusste nicht, wohin mit mir“, erzählt der Software-Ingenieur. Am Ende lief er Marathon, dann sogar 60 Kilometer um den Chiemsee herum. „Bis meine Frau mich zum Arzt geschickt hat“, erzählt Holger S. Er bekam die Diagnose: Depression. „Das hat mir schon die Beine weggezogen“, sagt er. „In der ersten Sekunde habe ich mich geschämt.“ Männer haben doch keine Depressionen.
Mit dieser Ansicht ist Holger S. nicht allein. Depressionen gelten als „Frauenkrankheit“, die sich in Tränen, Zurückgezogenheit, Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit äußert. Laut Statistik erkranken Frauen tatsächlich etwa zwei- bis dreimal so häufig. Nur ein Viertel der Psychotherapie-Patienten sind männlich.
Männer begehen dreimal so oft Selbstmord als Frauen
Doch so einfach, wie es aussieht, ist es nicht: Depressive Männer begehen dreimal so häufig Selbstmord wie depressive Frauen. Anne Maria Möller-Leimkühler hat dafür eine Erklärung: „Männer erkranken genauso oft an Depressionen – nur wird es bei ihnen nicht diagnostiziert oder behandelt“, sagt die Sozialwissenschaftlerin an der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Die Professorin forscht seit Jahren über die sogenannte männliche Depression, die sich anders zeigt als die weibliche Variante. Wie Studien ergaben, geht sie eher einher mit Aggressionen und Wutausbrüchen, verstärkten Impulsreaktionen und Risikoverhalten, Alkoholismus und Drogenmissbrauch. Zum Teil liegen diese Unterschiede daran, dass Männer und Frauen anders mit Stress umgehen – rein biologisch gesehen. „Unter Stress werden Männer eher noch risikofreudiger und impulsiver, während Frauen meistens noch vorsichtiger werden“, sagt Möller-Leimkühler. Der Serotoninmangel, ein typisches Kennzeichen einer Depression, steigert bei Männern die Impulsivität und Aggressivität, während Frauen mit depressiver Verstimmung reagieren, wie eine US-Studie ergeben hat.
Oft kommen Schlafstörungen zur Depression hinzu
Oft kommen, wie bei Holger S., Schlafstörungen hinzu. „Ich dachte lange, die Schlaflosigkeit wäre die Ursache für meine Gereiztheit und Aggressivität“, sagt er. Obwohl er ein sehr ruhiger und ausgeglichener Mensch sei, habe er häufiger die Geduld verloren. „Mein gereizter Zustand verschlimmerte sich. Ich war sogar gegenüber meinen Haustieren aggressiv und ungeduldig.“
Viele Betroffene wüssten nicht, dass sie erkrankt seien, meint die Sozialwissenschaftlerin und fügt hinzu: „Sie merken nur, dass etwas nicht stimmt – aber die Krankheitseinsicht fehlt.“ Auch Holger S. fühlte sich nicht krank. „Ich dachte, es wäre einfach nur der Stress.“ Seine Frau war an Krebs erkrankt, und er empfand seinen Job zunehmend als fordernd. „Von sechs Uhr morgens bis 22 Uhr abends war da diese Belastung“, erzählt er. So trieb er Sport bis zum Exzess, ebenfalls ein klassisches Symptom der männlichen Depression. „Betroffene verfallen in diese Spirale des ,immer mehr‘, um nicht als schwach aufzufallen“, sagt Möller-Leimkühler. „Das sind männliche Abwehrstrategien: So versuchen Männer, mit Problemen klarzukommen.“
Im Schnitt vergehen sieben Jahre bis zur Diagnose
Die Wissenschaftlerin führt das auf die klassisch-männlichen Leitbilder zurück: Der Mann solle Geld verdienen, Probleme lösen und anpacken und darf keine Angst, Schmerzen und Trauer kennen. Hilfe suchen die erkrankten Männer deshalb selten: „Ich dachte, ich müsste mich allein darum kümmern“, sagt Holger S. Andere suchen Rettung in Arbeit, Alkohol und Nikotin. „Das sind Versuche der Selbsttherapie und Fluchtwege aus der Depression“, sagt Möller-Leimkühler. So stünden sich viele Männer mit ihrem Autonomiebedürfnis der rechtzeitigen Behandlung selbst im Weg, sagt die Sozialwissenschaftlerin.
Im Schnitt vergehen bei Männern etwa sieben Jahre zwischen den ersten Symptomen und der Diagnose. „Männer gehen einfach nicht rechtzeitig zum Arzt, schon gar nicht wegen einer angeblichen Frauenkrankheit“, sagt Möller-Leimkühler. Zu groß ist die Scham vor der Gesellschaft und sich selbst. So spielen die sozialen Faktoren mit den biologisch bedingten Unterschieden zusammen – was fatal ist für das starke Geschlecht.
Problematisch ist vor allem, dass die spezifischen Symptome der „männlichen Depression“ noch unbekannt sind. „Viele Hausärzte erkennen die Krankheit nicht und suchen nur nach körperlichen Ursachen“, erklärt Möller-Leimkühler. Sie arbeitet zurzeit an einem Fragebogen zur Depression, der auch nach männertypischen Stresssymptomen fragt. Er soll Hausärzten helfen, auch bei Männern die richtige Diagnose zu stellen.
Weiter Weg zurück zur Normalität
Wie weit der Weg zurück in ein normales Leben für depressive Männer heute immer noch ist, musste Holger S. erfahren. Zehn Jahre dauert es, bis er die Diagnose bekam und noch einmal Monate, bis er einen Therapeuten fand, der ihn ernst nahm und dem er sich öffnen konnte. „Ich fühlte mich von vielen nicht verstanden.“ Schließlich fasste er doch Vertrauen, und die Behandlung war erfolgreich. „Hat sich ein Betroffener erst einmal zu einer Therapie durchgerungen, schlägt diese genauso gut an wie bei Frauen“, sagt Möller-Leimkühler. Allerdings könnten die Therapien noch besser auf männliche Bedürfnisse zugeschnitten werden, meint die Wissenschaftlerin – beispielsweise durch einen lösungsorientierten Gesprächsansatz.
Wer bei einem Partner, Freund oder Kollegen eine Depression vermutet, sollte ihn nicht direkt darauf ansprechen. Vielmehr solle man den Betroffenen dazu ermuntern, mehr auf seine Gesundheit zu achten und ihn behutsam zu einem Arztbesuch überreden, empfiehlt Möller-Leimkühler. „Kontakt halten und ihn immer wieder zu sozialen Aktivitäten anregen, das ist sehr wichtig“, sagt sie. „Auf keinen Fall sollte man Druck ausüben.“
Auch Holger S. hat die Besserung seiner Frau zu verdanken. „Ohne den Hinweis meiner Frau hätte ich es nicht geschafft, zum Arzt zu gehen“, erzählt er. „Ich denke, das ist typisch. Die Männer wollen einfach nicht zugeben, dass sie krank sind.“
Die vielen Gesichter der Depression
Klassische Depression
In Deutschland leiden etwa vier Millionen Menschen an unterschiedlichen Formen der Depression. Betroffene fühlen sich oft hilflos, traurig und antriebslos. Sie vernachlässigen soziale Kontakte, ziehen sich in ihre negative Gedankenwelt zurück und leiden oft unter Appetitlosigkeit und Schlafstörungen. Wer mehr als zwei Wochen zwei dieser Symptome zeigt, gilt bereits als depressiv. Depressionen können auch über Jahre andauern und sich in körperlichen Beschwerden äußern.
Manisch-depressive Störungen
Phasen der Niedergeschlagenheit wechseln sich mit Phasen des Hochgefühls, Tatendrangs und der Selbstüberschätzung ab. Ärzte sprechen auch von einer bipolaren-affektiven Störung.
Wochenbettdepression
Bis zu zehn Prozent der Mütter erkranken unmittelbar nach der Geburt eines Kindes an einer schwereren Depression, die über mehrere Monate dauern kann. Diese Störung trifft einer englischen Studie zufolge auch acht Prozent der Väter.
Winterdepression
Diese Form der saisonalen affektiven Störung tritt – wie der Name sagt – nur zu einer bestimmten Jahreszeit auf. Betroffene sind niedergeschlagen, äußerst müde und haben oft Heißhunger auf Süßes. Ärzte vermuten, dass ein Mangel an Licht und der daraus resultierende Mangel an Serotonin dafür verantwortlich ist.
Organische Depression
Hier ist die Niedergeschlagenheit nur ein Symptom einer physischen Krankheit, etwa einer Schilddrüsenerkrankung.