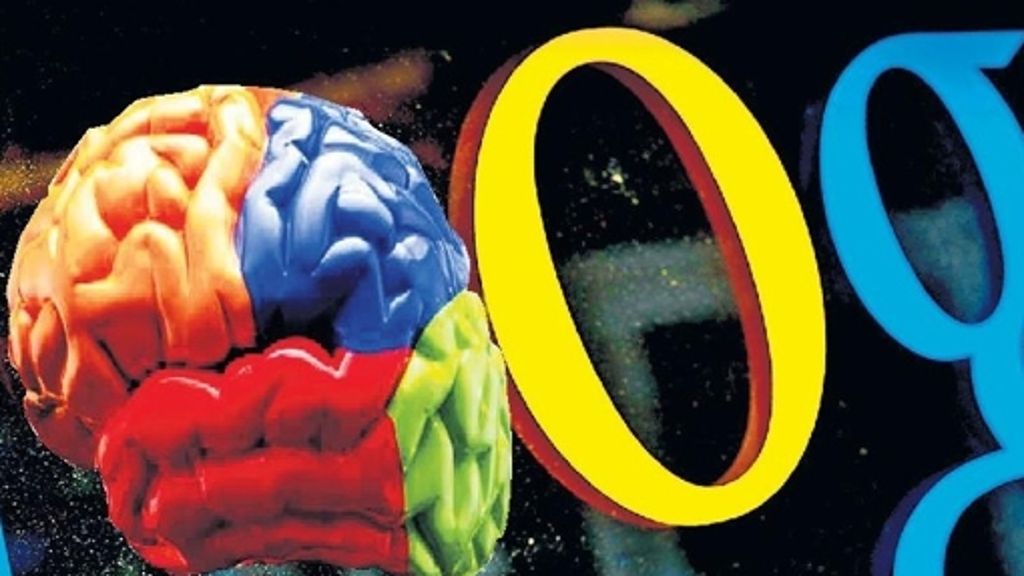Das Internet weiß fast alles – aber damit müssen Nutzer auch umgehen können. Es genügt nicht zu wissen, wo man was nachschlagen kann. Forscher fordern eine neue Art des kritischen Denkens.
Stuttgart - Früher waren Menschen wandelnde Telefonbücher. Sie wussten die Rufnummern der Familie und zahlreicher Freunde und kannten zusätzlich noch Adresse und Postleitzahl. Dieses Wissen geht verloren. Als der Bundesverband Digitale Wirtschaft Handynutzer nach der Telefonnummer des Partners fragte, musste die Hälfte der Befragten passen. Heute ist Wissen immer nur ein paar Klicks entfernt. Suchmaschinen liefern aus dem Internet die Fakten, die früher als Zeichen guter Allgemeinbildung galten und Anerkennung beim Gegenüber auslösten: Je nach Gusto die wichtigsten Filme von Woody Allen, die Namen der deutschen Mittelgebirge oder die Aufstellung der Nationalmannschaft im WM-Endspiel 1974. Mehr noch: selbst wer nach Filmen von Woddy Allan sucht, erhält trotz falscher Schreibweise die richtigen Antworten.
„Das Internet ist vor allem für Jugendliche ein Teil ihres Gedächtnisses geworden“, beschreibt der Philosoph Michael Pauen die Situation. Diese nüchterne Analyse einer Veränderung interpretieren die Kritiker als eine Bedrohung des spezifisch Menschlichen. Sie wittern bereits den Untergang von Bildung und Kultur, in deren Strudel der Verstand gleich mitgerissen wird. Sie klagen, dass Schüler keine Gedichte mehr auswendig kennen und den Taschenrechner für einfache Rechenaufgaben benötigen. Michael Pauen von der Humboldt-Universität Berlin mag solche Bedenken nicht so hoch aufhängen. Er wischt sie vom Tisch. „Wir entscheiden uns für ein anderes Wissen“, sagt er. Das habe der Mensch schon immer so praktiziert. Seit Generationen folgen wir einem Prinzip: verwenden oder vergessen.
Sind Internet und Kreativität Freunde oder Feinde?
Folgt man dieser Argumentation, dann erlebt unsere Gesellschaft gerade diese Phase des Umbruchs mit voller Wucht. Das Internet verändert unser Denken. Die Älteren müssen bekümmert feststellen, dass die nächste Generation ihr Wissen aus Quellen sammelt, die die Älteren oft nicht kennen und denen sie misstrauen. Sie sorgen sich – und Pauen gibt ihnen teilweise recht. Durch diese Veränderung könnten erlernte Fähigkeiten verkümmern, sagt der Philosoph und schränkt aber gleich ein: „Das kann schlimm sein, muss es aber nicht.“ Schließlich könne der Mensch falsche Entwicklungen korrigieren und auch die Telefonnummer des Partners wieder auswendig lernen, falls das nötig sei und wieder wichtig werde.
Doch ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Hannah Monyer hält das Internet für das Gedächtnis nicht unbedingt für förderlich. Die Neurobiologin der Universität Heidelberg warnt vor allem vor Oberflächlichkeit. Sie meint damit nicht den Gehalt der Information, sondern ihre Speicherung im Gedächtnis. Wer sich kreativ mit Wissen beschäftige, behalte es länger, sagt Monyer. Das klingt nach Binsenweisheit, aber Monyer sieht das Internet klar im Nachteil: Wer sich eine Website nur anschaue, werde sich den Inhalt schlechter merken können. Dieser oberflächliche Nutzer wird schneller vergessen, was er gelesen hat. Es gebe Hinweise, dass die Navigationssysteme den Orientierungssinn der Menschen verändern könnten, berichtet Monyer. Aus Tierversuchen sei bekannt, dass Mäuse, die auf einem Wagen durch ein Labyrinth gezogen wurden, sich den Weg schlechter merken als solche, die ihn selbst suchen.
Derzeit kann die Wissenschaft nicht sagen, ob die extreme Verwendung des Internets Auswirkung auf die Struktur des Gehirns hat, weder positiv noch negativ. Eine Studie mit Heavy-Usern wäre wohl sinnvoll, existiert aber noch nicht. Andererseits lädt deren Aussagekraft schon vorweg zu Zweifeln ein. Denn es gehört zu den Stärken des Gehirns, sich den Anforderungen anzupassen. Das Gehirn verändert sich ständig. Wer sein Denkorgan fordert, verändert auch dessen Struktur. So gerät Monyers Einwand weniger zur Schelte des Internets, sondern mutiert zum Aufruf zur Kreativität. Was die alte Debatte befeuert, ob Internet und Kreativität am besten als Geschwister oder als Feinde beschrieben werden.
Auch gegen die Schrift regte sich einst Widerstand
Vielleicht wüssten die alten Griechen eine Lösung. Michael Pauen bringt sie als Kronzeugen. Denn die antike Hochkultur erlebte den Beginn eines dramatischen Umbruchs, der Parallelen zur heutigen Zeit aufweist. Als sich vor mehr als 2300 Jahren die Schrift langsam durchsetzte, schwand die Bedeutung einer bis dahin unverzichtbaren Schicht von anerkannten Intellektuellen: Die Gelehrten, die die Werke von Homer, Sophokles und Aischylos auswendig kannten und weitergaben, erhielten Konkurrenz durch Bücher in Bibliotheken.
Sorge bereitet vielen Experten der Zugang zum scheinbar unbegrenzten Wissenspool, der für die meisten Menschen den gleichen Namen trägt: Google. Die Internetnutzer müssten wissen, dass die Suchmaschine ihre Ergebnisse nicht nach den Kriterien Wahrheit oder Weisheit ordne, sondern wirtschaftliche Interessen und persönliche Neigungen eine große Rolle spielten, sagt Thomas Rathgeb von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg. Diese Form der Medienkompetenz fehle vielen Nutzern. Ein weiteres Problem sind die Betreiber der Websites. Sie liefern häufig keine objektiven Informationen, sondern versuchen, sich selbst im besten Licht darzustellen. Scheinwissen, das Kritik gerne ausblendet.
Michael Pauen sieht darin keinen Grund für die Verbannung des Internets. Es sei wichtig, verschiedene Informationsquellen zu kennen und zu nutzen. Das moderne Wissen stellt demnach andere Anforderungen an seine Benutzer. Offen bleibt die Frage, wie es gelingt, dass die Menschen diese Anforderungen erkennen – und erfüllen.